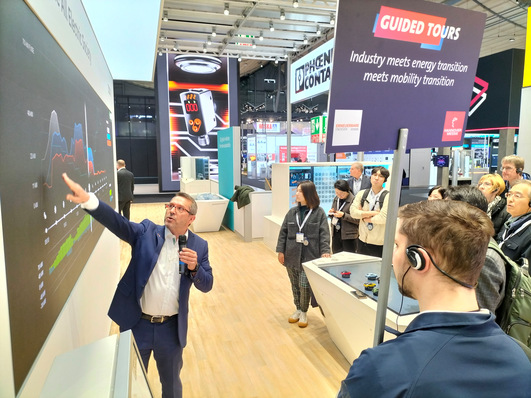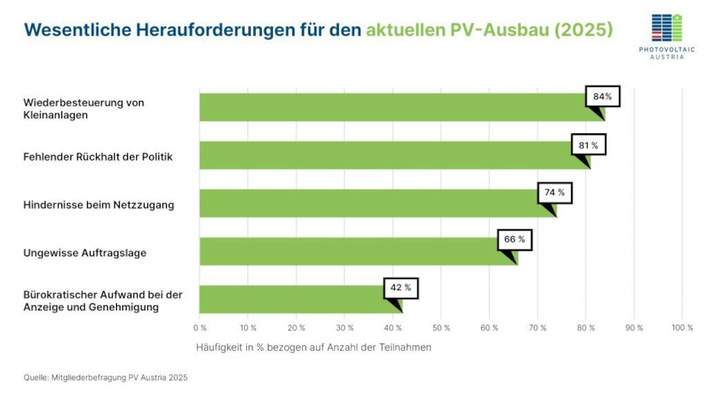Die Speicherung von abgeschiedenem Kohlendioxid (CO₂) unter der deutschen Nordsee ist keine Alternative zum Klimaschutz. Der jetzt vorgelegten Zwischenbericht des Forschungsverbundes „GEOSTOR“ bestätigt zwar die Möglichkeit der CO₂-Verpressung, des sogenannten Carbon Capture and Storage (CCS), schränkt sie aber gleichzeitig ein: Wegen der begrenzten Kapazitäten und möglicher Umweltrisiken sollte dort nur jene CO₂-Restmenge deponiert werden, deren Entstehung sich trotz konsequenter Klimaschutzpolitik nicht vermeiden lässt, heißt es in dem Bericht. Er präsentiert Ergebnisse aus den ersten drei Jahren Forschung zu den Potenzialen und Risiken einer CO₂-Speicherung unter der deutschen Nordsee.
Noch viele Herausforderungen sind zu lösen
„Die wesentlichen Herausforderungen liegen aktuell darin, Vorkehrungen zu treffen, mit denen Leckagen aus dem Speichergestein vermieden werden können. Zudem gilt es, den Lärm bei Arbeiten wie der Speichererkundung und -überwachung zu minimieren sowie Lösungen für die absehbaren Nutzungskonflikte, beispielsweise Windkraftanlagen, zu finden und diese in der Meeresraumplanung zu berücksichtigen“, erläutert „GEOSTOR“-Koordinator Klaus Wallmann. Außerdem müsse der nationale Rechtsrahmen aktualisiert werden, um die CO₂-Speicherung in der deutschen Nordsee seewärts der Küstengebiete zu ermöglichen.
Damit geben die Wissenschaftler der Politik zwar grünes Licht für die umstrittene und bislang verbotene Speicherung des Klimagases.Schon während der Regierung aus SPD, FDP und Grünen waren erste Gesetzentwürfe diskutiert worden. Auch während der derzeit laufenden Koalitionsverhandlungen spielt das Thema eine Rolle.
CCS: Wichtiger Baustein oder Ausrede?
Befürworter sehen in der Speicherung von CO₂ einen wichtigen Baustein, um Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen: Schwer vermeidbare Emissionen aus der Industrie könnten so vermindert und unvermeidbare Restemissionen kompensiert werden. Kritiker befürchten hingegen, die technischen Möglichkeiten würden dazu führen, dass die Bereitschaft, CO₂-Emissionen gar nicht erst entstehen zu lassen, deutlich abnimmt.
Klimawandel beschleunigt sich wieder – Klimaschützer gegen Ersatzmaßnahmen
In ihrer Untersuchung konzentrierten sich die Wissenschaftler auf den Mittleren Buntsandstein, der als wichtiges Speichergestein für CO₂ angesehen werden könne, heißt es in dem Bericht. Dabei wurden nur Strukturen berücksichtigt, bei denen das injizierte Kohlendioxid in einem relativ eng begrenzten Bereich am Speicherstandort verbleibt und das Speichergestein durch eine mindestens 20 Meter mächtige Schicht aus Barrieregesteinen überdeckt ist. Die so ermittelte statische Speicherkapazität in der deutschen Ausschließlichen Wirtschaftszone in der Nordsee beträgt circa 0,9 bis 5,5 Milliarden Tonnen CO₂. Bei der Berechnung wurde angenommen, dass fünf bis 20 Prozent des Porenraums im Buntsandstein für die Speicherung genutzt werden können. Der tatsächlich nutzbare Anteil könne aber, je nach Standortbedingungen, geringer ausfallen. Daneben gebe es auch Möglichkeiten, in anderen Gesteinsformationen Kohlendioxid zu speichern: circa 11 bis 65 Millionen Tonnen CO₂ könnten in jurassischen Speicherstrukturen im nordwestlichsten Teil der deutschen Nordsee, dem sogenannten Entenschnabel, gespeichert werden.
Roadmap 2045: So will die Kalkindustrie zur CO₂-Senke werden
Wie hoch werden die Restemissionen sein?
Die Unsicherheit über die Aufnahmekapazitäten ist also noch groß. Gleichzeitig ist offen, wie groß denn die schwer vermeidbaren Restemissionen tatsächlich sind. Die Stiftung Klimaneutralität rechnet trotz Erreichen der Klimaneutralität 2045 mit Restemissionen von 63 Millionen Tonnen pro Jahr, die durch natürliche CO₂-Senken, etwa durch die Wiedervernässung von Mooren, und negative Emissionen durch CCS ausgeglichen werden könnten. Doch auch hier gibt es erhebliche Unsicherheit, wie die Stiftung einräumt: Die Datenlage und Prognosen bezüglich natürlicher Senken seien nach wie vor sehr ungenau, heißt es auf ihrer Homepage. Zudem bestehe die Gefahr, dass aufgrund des Klimawandels in den nächsten Jahrzehnten Wälder und Böden zu CO₂-Quellen statt -Senken werden. Bei Thema CCS fehle es an Infrastruktur. Zudem seien „massive Lernkurveneffekte für die Technologie der CO₂-Gewinnung aus der Atmosphäre“ erforderlich.