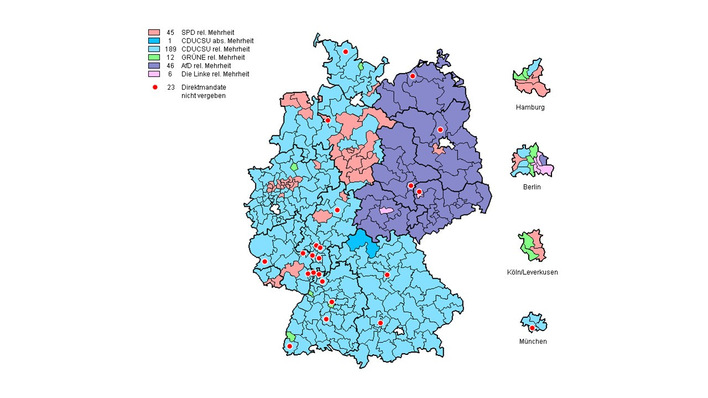Deutschland hat in den letzten Jahren beim Ausbau von Wind- und Solarenergie beachtliche Fortschritte gemacht. Doch der jüngst veröffentlichte Green Transition Scenarios Report 2024 des norwegischen Energieunternehmens Statkraft zeigt: Die reine Erzeugung reicht nicht. Ohne massive Investitionen in flexible und saubere Lösungen droht der Energiewende die Luft auszugehen.
Hier einige Kernergebnisse des Berichts:
Inmitten einer neuen sicherheitspolitischen Lage und einer fragmentierteren politischen Landschaft wird der rasche Wandel im Energiesektor weltweit weiter voranschreiten – angetrieben durch sinkende Kosten für erneuerbare Energien sowie durch Klima- und Energiesicherheitsbedenken. In allen Szenarien von Statkraft ersetzen erneuerbare Energien fossile Brennstoffe – wenn auch in unterschiedlichem Tempo und Ausmaß.
Lesen Sie auch: Weltweiter Rekordzubau bei Erneuerbaren
1.Wind- und Solarenergie sind die klaren Gewinner
Im Green Transition Scenario vervierfacht sich ihr Anteil bis 2030 und steigt bis 2050 auf das 13-Fache. Selbst im Delayed Transition Scenario ist ein starkes Wachstum zu verzeichnen – mit einer Versechsfachung bis 2050. Die Solarstromerzeugung wächst bis 2050 um das Achtfache, während die Winderzeugung im Szenario „Grüner Übergang“ um das Fünffache von heute zunimmt. Der Stromsektor wird bis 2050 vollständig dekarbonisiert.
Lesen Sie auch: Verschleppte Energiewende gefährdet Wirtschaftswachstum
2. Kernenergie wächst nicht im selben Maß
Auch die Kernenergie wächst in allen Szenarien, jedoch nicht in dem Maße wie Wind- und Solarenergie. Ihr Ausbau wird durch hohe Kosten, lange Projektlaufzeiten, regulatorische Hürden und die zunehmende Konkurrenzfähigkeit der Erneuerbaren eingeschränkt.
Lesen Sie auch: Klimagerechtigkeit – Reiche Bevölkerung steht auf der Bremse
3. CO₂-Ausstoß führt zu bis zu 2,4 Grad laut Szenarios
Die weltweiten energiebedingten CO₂-Emissionen sinken in allen Szenarien bis 2050 – entsprechend einem Pfad, der zu einer globalen Erwärmung von 1,9 bis 2,4 °C führt.
4. Transformation trotz Krieg und Krisen
Der europäische Wandel setzt sich in einer geopolitisch angespannten Welt fort – allerdings mit veränderten Antriebsfaktoren. Selbst im Delayed Transition Scenario findet ein umfassender Wandel statt, begünstigt durch sinkende Clean-Tech-Kosten. Um jedoch die EU-Klimaziele im Green Scenario zu erreichen, ist ein stärkerer politischer Impuls erforderlich.
5. Volatile Energien bleiben Herausforderung
Der hohe Anteil wetterabhängiger erneuerbarer Energien im Stromsystem bleibt eine Herausforderung – doch sie ist bewältigbar durch einen parallelen Ausbau aller Arten sauberer, flexibler Lösungen wie Batteriespeicher, flexible Wasserkraft, Laststeuerung und eine starke Marktvernetzung.
Das Erreichen der Netto-Null-Emissionen in der EU wird durch Märkte, Technologien und politische Maßnahmen ermöglicht, die sich gegenseitig verstärken.
6. Wärmepumpen legen zu
Der Anteil der Elektrizität an der Gesamtenergienachfrage in der Industrie verdoppelt sich auf einen Anteil von 56 Prozent im Jahr 2050 in Green. Darüber hinaus ist 25 Prozent Anteil sauberer Wasserstoff. Mit Hilfe des Abbaus von Kohlenstoff wird die Industrie bis 2040 fast eine Nettonullstellung erreichen.
In den Szenarien wächst die Anzahl der Wärmepumpen in Gebäuden bis 2050 auf das Fünf- bis Siebenfache. Der Anteil von Elektrizität am Endenergieverbrauch in der Industrie verdoppelt sich im Green Scenario bis 2050 auf 56 Prozent. Zusätzlich machen saubere Wasserstofflösungen einen Anteil von 25 Prozent aus. Mithilfe von CO₂-Abscheidung und -Speicherung (Carbon Removals) nähert sich die Industrie bis 2040 nahezu der Klimaneutralität.
7. 70 Prozent Elektrizität im Verkehr
In unseren Szenarien wächst die Zahl der Wärmepumpen in Gebäuden von heute bis 2050 um das bis Siebenfache.
Im Verkehrssektor wird der Anteil von Elektrizität am Endenergieverbrauch bis 2050 voraussichtlich fast 70 Prozent erreichen – verglichen mit lediglich 2 Prozent heute. Die Stromerzeugung durch Photovoltaik verachtfacht sich bis 2050, während die Windkraft um das Fünffache wächst. Der Stromsektor wird bis dahin vollständig dekarbonisiert sein.
8. Effizienz steigt
Verbesserungen der Energieeffizienz und Veränderungen im Verbrauchsverhalten werden laut Green Scenario den Endenergieverbrauch bis 2050 um 36 % senken (im Delayed Scenario um 20 Prozent).
Laut dem Bericht wird sich der Anteil erneuerbarer Energien am globalen Strommix bis 2050 vervielfachen – selbst in einem verzögerten Transformationsszenario. Für Deutschland jedoch stellt sich eine andere, grundlegende Frage: Wie können die volatilen Erzeugungsspitzen von Wind und Sonne effizient ins Netz integriert werden?
Statkraft sieht hier erheblichen Nachholbedarf. In der Analyse heißt es, dass „eine Vielzahl sauberer und flexibler Energielösungen ungenutzt bleibt“, obwohl gerade sie entscheidend seien, um eine sichere, reibungslose und bezahlbare Integration der Erneuerbaren zu ermöglichen. Speicherlösungen und ein flexibleres Netz sollen laut Szenarienmodell den größten Beitrag zur Verdopplung der Flexibilitätskapazitäten leisten, gefolgt von smarter Laststeuerung und dem Einsatz sauberer Gaskraftwerke als Reserve.
Speicher, Netze, Wasser – was jetzt gebraucht wird
Statkraft betont insbesondere die Rolle von Wasserkraft und Batteriespeichern als Schlüsseltechnologien. „Nur mit einer ausgewogenen Kombination aus sauberen, flexiblen Lösungen lässt sich die Energiewende effizient umsetzen“, so Mari Grooss Viddal, Head Analyst bei Statkraft.
Gleichzeitig müsse Europa seine Rahmenbedingungen anpassen, damit Clean-Tech-Technologien wirtschaftlich florieren können. Zwar habe die EU in der vergangenen Legislaturperiode mit Gesetzen wie dem „Netto-Null-Industrie-Gesetz“ und der Rohstoffverordnung wichtige Grundlagen gelegt. Doch die Expertin mahnt an, dass die europäische Fertigung für Schlüsseltechnologien gezielt gefördert und Engpässe in der Zulieferung beseitigt werden müssten.
Kosten sinken – aber nur mit offenem Markt und politischem Rückhalt
Aktuell seien die Kosten für grüne Technologien wie Solarmodule oder Batteriespeicher bereits durch chinesische Überangebote gesunken. Viddal erwartet, dass sich dieser Trend durch technologische Fortschritte, Standardisierung und Wettbewerb weiter verstärken wird. Auch die Herausforderungen im Bereich der Windkraft sollen so überwunden werden. Schwimmende Offshore-Windanlagen gelten bislang als teuer, könnten jedoch gegen Ende des Jahrzehnts einen technologischen Durchbruch erleben – zumindest im optimistischen Green Scenario.
Gleichzeitig warnt Statkraft, dass geopolitische Spannungen und Handelsbarrieren die Energiewende empfindlich verzögern könnten. Im sogenannten Delayed Transition Scenario würde die Transformation zwar ebenfalls stattfinden – aber langsamer und mit größeren Reibungsverlusten.
Warum die CO₂-Emissionen trotzdem sinken könnten
Trotz aller Unsicherheiten zeigt der Bericht: Die globalen CO₂-Emissionen könnten selbst bei verzögerter Energiewende signifikant sinken. Möglich macht das die zunehmende Wirtschaftlichkeit von Wind- und Solarenergie – auch in Regionen mit schwächeren politischen Impulsen.
In der Studie wird deutlich, dass fossile Kraftwerke bereits ab dem kommenden Jahrzehnt stark an Bedeutung verlieren könnten. Die Zahl der Betriebsstunden sinkt, während Elektromobilität, Wärmepumpen und saubere Industriekonzepte an Boden gewinnen – vor allem, weil sie sich wirtschaftlich rechnen.
Fest steht: Der Klimawandel wartet nicht auf politische Kompromisse oder technologische Reife. Der Weg zu einem CO₂-armen Energiesystem führt über konsequenten Ausbau erneuerbarer Energien – aber eben auch über flexible Speicher, intelligente Netze und stabile politische Rahmenbedingungen. Deutschland steht dabei nicht nur vor einer technologischen, sondern vor einer systemischen Herausforderung. Und der Report von Statkraft macht klar: Wer jetzt nicht investiert, wird später den Anschluss verlieren.

Statkraft
Übergang auch durch die Notwendigkeit gedrängt, die Widerstandsfähigkeit Europas zu stärken und seine industrielle Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.