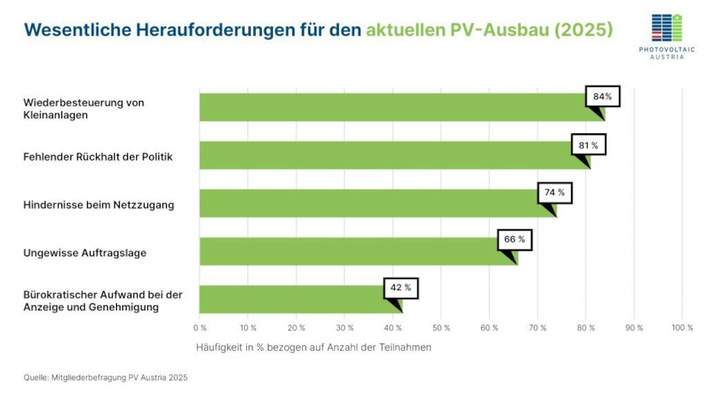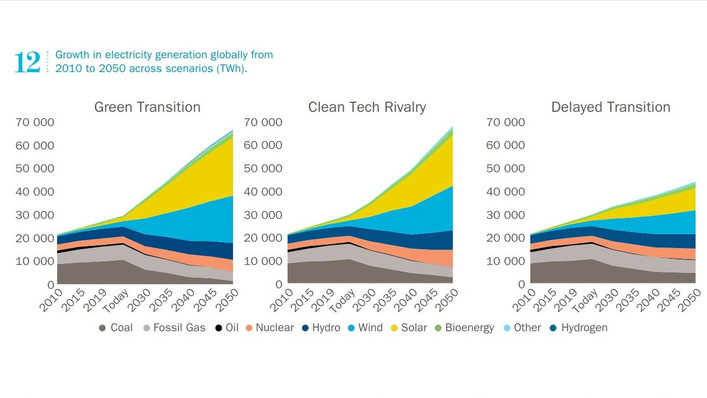In den vergangenen Jahren haben sich die Energiemärkte stark verändert, was zu einer erhöhten Volatilität auf den Spotmärkten geführt hat. Besonders seit der Corona-Pandemie gibt es extreme Preisspitzen und -abfälle, was zu einem häufigeren Auftreten negativer Strompreise führt. Diese entstehen, wenn die Einspeisung von erneuerbaren Energien (EE) wie Wind und Sonne den Verbrauch übersteigt. Für Betreibende von PV- oder Windanlagen, die planbare Erlöse wünschen, ist das problematisch. Batteriespeicher hingegen profitieren von der Preisspanne und nicht von den Preisspitzen, wodurch ihre Flexibilität an Wert gewinnt. Das führt seit wenigen Jahren dazu, dass der deutsche Markt für große Batteriespeicher in rasantem Tempo wächst und das auch erst der Anfang ist.
Wieso treten negative Strompreise immer häufiger auf?
Vor allem im Sommer kommt es an sonnigen Tagen - wenn in ganz Deutschland PV-Anlagen viel Strom ins Netz einspeisen - vermehrt zu negativen Strompreisen, wie in der nachfolgenden Entwicklung der negativen Strompreise von 2015 bis 2024 dargestellt.

EnBW
Inzwischen tritt dieses Phänomen nicht mehr nur überwiegend an Feiertagen auf (an denen der bundesweite Stromverbrauch i.d.R. naturgemäß geringer ist), sondern ist auch an ganz normalen Wochentagen zu beobachten. Betreibende klassischer EE-Anlagen müssen dann entweder für ihren eingespeisten Strom zahlen oder ihre Anlagen abregeln. Batteriespeicher hingegen können den Strom aufnehmen und dafür sogar Geld erhalten. Die Entwicklung der negativen Strompreise ist somit durchaus als deutliches Marktsignal für mehr Flexibilität zu interpretieren.
Regulatorische Änderungen: Das ist neu im § 51 EEG
Diese Entwicklung wird für PV-Anlagenbetreibende durch das am 25.02.2025 in Kraft getretene „Solarspitzengesetz“ weiter verschärft. Denn zukünftig erhalten Neuanlagen keine EEG-Vergütung mehr in Zeiten von negativen Strompreisen. So verringert sich der anzulegende Wert dann schon ab der ersten Viertelstunde mit negativen Preisen auf null. Die Anzahl an Viertelstunden, in denen sich die EEG-Vergütung auf null reduziert hat, wird jedoch weiterhin an die 20-jährige EEG-Förderzeit angehängt. Je mehr Stunden mit negativen Preisen also im Jahr auftreten, desto weniger Geld wird eine alleinstehende PV-Anlage verdienen.
Boom für den Batteriespeichermarkt
Die steigende Nachfrage nach Flexibilität und somit die wachsende Bedeutung von Batteriespeichern sind deshalb offensichtlich. Kein Wunder, dass auf dem Batteriespeichermarkt von einer “Goldgräberstimmung” die Rede ist. Im Jahr 2024 gab es 457 Stunden mit negativen Strompreisen, ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu 301 Stunden mit negativen Strompreisen im Jahr 2023. Diese Entwicklung zeigt, dass der Batteriespeichermarkt enormes Wachstumspotenzial hat, da die Volatilität weiter zunehmen wird. Batteriespeicher erwirtschaften ihre Erlöse in den Preisspannen durch maximale Preishöhen und -tiefen, indem sie bei negativen Strompreisen aus dem Netz laden und dafür Geld erhalten. Dieses Geschäftsmodell treibt die Nachfrage nach Speicherkapazitäten und flexiblen Lösungen an. Laut dem Bundesverband Solarwirtschaft wird eine Verfünffachung der installierten Kapazität großer Batteriespeicher in Deutschland erwartet, wie die nachfolgende Grafik verdeutlicht.

BSW
Diese Entwicklung ist entscheidend für eine erfolgreiche Energiewende, da sie hilft, die wachsende Photovoltaikleistung besser in das Stromsystem zu integrieren. Für Betreibende EE-Anlagen bedeutet ein ergänzender Speicher eine Absicherung ihres Risikos im Portfolio.
Welche Möglichkeiten von Hybrid-Kraftwerken gibt es?
Für die Realisierung von Hybrid-Kraftwerken gibt es verschiedene Konstellationen:
Option 1: Innovationsausschreibung
Diese Option steht nur für Neuanlagen zur Verfügung. Der EE-Park und der Batteriespeicher teilen sich einen gemeinsamen Netzanschluss. Ein Netzbezug des Batteriespeichers ist nicht zulässig; dieser wird ausschließlich aus dem onsite EE-Park beladen. Die Batterie optimiert die Einspeisung des EE-Parks über die Kurzfristmärkte Day-Ahead und Intraday. Diese Kombination wird im Rahmen der Innovationsausschreibung als Teil des EEG gefördert und bietet einen einfachen Einstieg in die Batterievermarktung.
Option 2: Co-Location merchant
Bei dieser Option wird das Hybrid-Kraftwerk ohne Förderung wie in der Innovationsausschreibung errichtet, z.B. durch Nachrüstung von Batterien in EE-Bestandsparks. Für diese Option ist es notwendig, dass ein Netzbezug des Batteriespeichers sichergestellt ist. Hier ist jedoch Vorsicht geboten, insbesondere im Hinblick auf mögliche bereits existierende Förderungen des bestehenden Solarparks. Wichtig ist hier die anlagenscharfe messtechnische und zählermäßige Trennung der Strommengen (Einspeisung und Bezug) zwischen EE-Park und Batterie, um zu vermeiden, dass eingespeiste EE-Mengen als Graustrom deklariert werden und der Solarpark damit eventuell seine EEG-Förderung verliert. Auch würde der erzeugte EE-Strom bei Einspeicherung in die „graue“ Batterie seine Förderfähigkeit verlieren. Die Batterie bezieht Strom somit ausschließlich aus dem Netz und nicht aus dem onsite EE-Park. Der EE-Park und der Batteriespeicher wechseln sich bei dieser Option bei der Nutzung des Netzanschlusses ab, d.h. der EE-Park hat in der Regel Einspeisevorrang und speist immer zu den Zeitpunkten ein, wenn er Strom produziert. In den übrigen Stunden wird die Batterie wie ein stand-alone Speicher „Multi-Market“ über die Regelenergie- und Kurzfristmärkte optimiert. Der Netzanschluss wird damit maximal effizient genutzt.
Option 3: Full Hybrid
Im Gegensatz zur Innovationsausschreibung, wo eine Beladung der Batterie nur aus dem EE-Park zulässig ist, und im Gegensatz zum Modell „co-location merchant“, wo die Batterie ausschließlich aus dem Netz belädt, soll durch das jüngst verabschiedete Solarspitzengesetz bis spätestens Ende Juni 2026 auch eine kombinierte Nutzung der Batterie möglich sein. In diesem Fall kann die Batterie sowohl Graustrom aus dem Netz als auch Grünstrom aus dem EE-Park laden, ohne dass die Grünstromeigenschaft des eingespeicherten EE-Stroms im ansonsten „grauen“ Batteriespeicher verloren geht. Dies würde eine kombinierte Optimierung der Batterie aus dem Multi-Market-Ansatz und der preisgesteuerten Einspeiseverschiebung der EE-Erzeugung erlauben. Einzelheiten zur Ausgestaltung dieser Option sind jedoch von der Bundesnetzagentur noch abschließen zu definieren.
Autor: Marcel Schepers, Produktmanager Flexibilitätsvermarktung, Virtuelles Kraftwerk bei EnBW
EnBW ist mit dem Thema Großbatteriespeicher auf der Intersolar als Teil der Smarter E vom 7. bis 9. Mai in München: Stand A5.280

ARTIS - Uli Deck