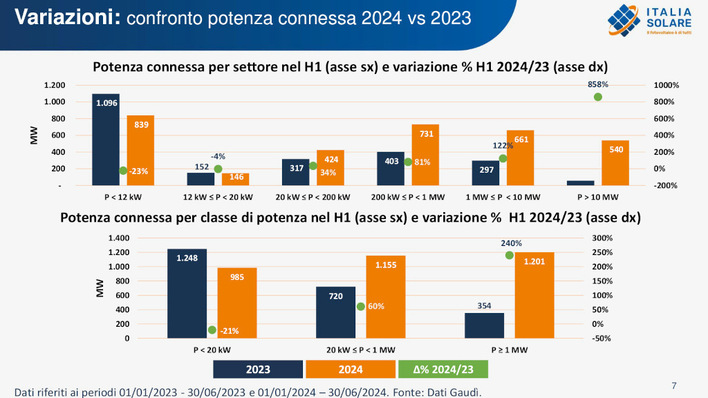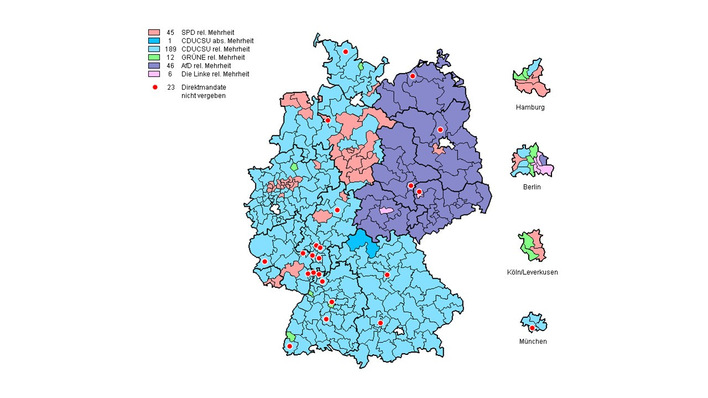Ackerfläche rein oder raus: Das ist ein Thema, das seit Jahren zwischen der Photovoltaikbranche, der Politik, den Kommunen und vor allem den Anwohnern debattiert wird. Immerhin war es der Bundesregierung vor zwei Jahren wichtig festzustellen, dass auf die Ackerflächen gefälligst Nahrungsmittel angepflanzt werden sollten und keine Solarmodule. Inzwischen hat sich der Wind gedreht. Man wolle offen diskutieren, wie die künftigen Ausschreibungen von Photovoltaikfreiflächenanlagen aussehen sollen. Da wird auch die Ackerfläche wieder ins Rennen geschickt.
Jetzt haben es die Umweltminister und Senatoren der Bundesländern noch einmal aufgegriffen. Auf der 83. Umweltministerkonferenz in Heidelberg ließen es sich die ostdeutschen Bundesländer nicht nehmen, noch einmal darauf hinzuweisen, dass sie keine Solaranlagen auf Ackerflächen wollen – mit Ausnahme von Berlin und Brandenburg. Nun mag es Berlin egal sein, ob die Solarkraftwerke auf Ackerflächen gebaut werden oder nicht. Schließlich ist die Hauptstadt nur marginal davon betroffen. Brandenburg zieht damit die Linie weiter. Denn immerhin scheint es der Regierung in Potsdam egal zu sein, ob die Lausitz nach Braunkohle umgegraben wird. Was machen da einige Solarmodule, die auf irgendwelchen Ackerflächen in der Mark aufgeständert werden.
Energiewende geht auch ohne Ackerfläche
Der rot-roten Regierung in Potsdam damit vorzuwerfen, sie würde die Energiewende ausbremsen, indem sie Solarparks auf Ackerflächen wieder zulassen wollen, funktioniert nicht. Denn die Ackerfläche eignet sich wunderbar für die Erschließung von Solarparks. Die Böden sind nicht kontaminiert und niemand muss alte Munition wegräumen, bevor die Montagegestelle in die Erde gerammt werden. Schließlich ist das ein zentrales Problem bei der Nutzung von Konversionsflächen. Inzwischen hat sich aber auch der Wind zwischen alter und neuer Energiewirtschaft gedreht. Waren die Vertreter des fossil-atomaren Energiezeitalters vor zwei Jahren noch gegen Solarmodule auf Äckern und Wiesen, sehen sie inzwischen darin kein Problem mehr. Jedenfalls steht es so in der Stellungnahme des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), der Interessenvertretung der alten Zentralisten der Energiebranche.
Die Akteure der Energiewende hingegen sprechen sich inzwischen gegen die Einbeziehung der Ackerflächen aus. Dazu gehört neben Greenpeace Energy auch der Deutsche Genossenschafts- und Raiffeisenverband. Der Grund: Ackerflächen sind zu einfach für Solarparks zu erschließen und damit ein gefundenes Fressen für die großen Energiekonzerne, endlich doch in die erneuerbaren Energien einzusteigen. Dabei würden aber die Bürgerprojekte und Energiegenossenschaften auf der Strecke bleiben, weil sie dann nicht mehr mithalten können. Immerhin haben diese Akteure die Energiewende bisher zu einem großen Teil mitgetragen und der Branche sind sie inzwischen lieb geworden. Außerdem haben die Unternehmen inzwischen auch mit der Konversionsfläche Erfahrungen gesammelt. Sie haben gemerkt, dass sie dann auf weniger Widerstand durch die Kommunen und vor allem die Anwohner stoßen.
Einspeisetarife gedeckelt
Es ist aber auch ein Argument der Vernunft. Denn während die Äcker und Wiesen auf dem Lande liegen, weit ab von urbanen Zentren, wo Menschen leben, die den Strom auch kaufen, sind die Konversionsflächen sowie alten Industrie- und Gewerbebrachen direkt in der Nachbarschaft zum Kunden. Was man dann bei der Erschließung der Ackerflächen einspart, zahlt man doppelt drauf für die Netzanbindung und den Stromtransport. Wer das wiederum finanziert, ist auch klar: der Endkunde. Denn dieser muss die Netzkosten bezahlen und wenn die Netzbetreiber ausbauen müssen, um den Solarstrom über weite Strecken zum Kunden zu bringen und dafür sogar noch zusätzliche Leitungen und Anschlusspunkte legen muss, dann wird es eben für diesen teuer. Bleiben die Ackerflächen aber von den Ausschreibungen ausgenommen, könnte die Entwicklung der Projekte teurer und die Einspeisetarife entsprechend höher werden. Das muss auch der Stromkunde bezahlen. Das Risiko bleibt dann aber überschaubar. Schließlich ist die Höhe der Einspeisetarife gedeckelt, was für die Netzentgelte nicht gilt. Deshalb kann der Stromkunde nur hoffen, dass das Bundeswirtschaftsministerium dieses Mal auf die Einwände hört und nicht einfach die Argumente der alten Energiewirtschaft übernimmt, wie sie es im Falle der EEG-Novelle gemacht hat. (Sven Ullrich)