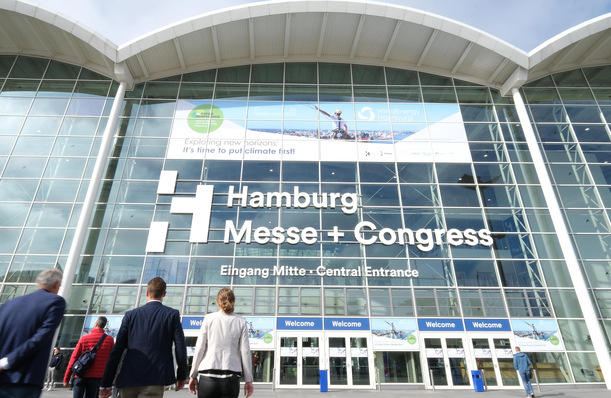Warum veranstaltet ein Speicherverband eine E-Mobilitätskonferenz? Der Bundesverband Energiespeicher Systeme (BVES) lud in Berlin zur Statuskonferenz „Flex-Hub Mobilitätswende – Ladelösungen als Chance für E-Mobilität und Energiesysteme“ – und Geschäftsführer Urban Windelen sah sich genötigt zunächst einmal klarzustellen, was es damit auf sich hat: Das S in BVES stehe für Systeme, nicht für Speicher, denn letztere würden immer mehr zum Schlüssel einer passenden Infrastruktur für Wärme, Stromversorgung und zunehmend auch Mobilitätsversorgung. Immerhin: 2023 gab es am Jahresende rund 1,4 Millionen vollelektrische Autos in Deutschland, mit einer gemeinsamen Batteriespeicherkapazität von gut 100 Millionen Kilowattstunden. Wenn man an bidirektionales Laden denkt, ergeben sich sehr viele Möglichkeiten.
„Speicher sind die Schweizer Taschenmesser der Energiewende: Sie können Flexibilität ins System bringen, nicht nur für die Mobilität, sondern für das gesamte Energiesystem. Unser Wort des Jahres ist darum Flexillienz.“ Auf seiner Vorstandsklausurtagung 2025 in Schluchsee hat der BVES das Papier „Endspurt 2030“ – eine Agenda mit zentralen energiepolitischen Forderungen erarbeitet. Im Mittelpunkt steht die Flexillienz des Energiesystems – eine Kombination aus Flexibilität, Resilienz und Intelligenz. Das Papier listet die Schritte auf, die notwendig sind, um das Potenzial der Energiespeicher zu entfesseln und die Energiewende effizient sowie wirtschaftlich voranzubringen. Die dort genannten fünf Kernforderungen waren auch auf der Konferenz immer wieder Thema:
Fünf Kernforderungen für ein zukunftssicheres Energiesystem:
1. Bürokratie abbauen und Energiewendeanlagen priorisieren
Die Umsetzung von Energiewendeprojekten in den drei Sektoren Strom, Wärme, Mobilität darf nicht durch langwierige Genehmigungsverfahren behindert werden. Das überragende öffentliche Interesse nach §11c EnWG muss konsequent in der Praxis Anwendung finden. Gleichzeitig braucht es einen schnelleren, digitalisierten und rechtssicheren Prozess für Netzanschlüsse und Speicherintegration.
2. Marktdesign anpassen – Dezentralität und Volatilität berücksichtigen
Erneuerbare Energien sind dezentral und volatil. Das Energiemarktdesign muss dies widerspiegeln, indem Energie, Leistung und Systemdienstleistungen regional, dynamisch und automatisiert gehandelt werden können. Eine umfassende Reform der Netzentgelte ist dafür essenziell.
3. Speicher in Verbindung mit Erzeugungsanlagen in den Fokus setzen Co-Location Anlagen stabilisieren die erneuerbare Erzeugung und helfen gleichzeitig dem Netz. Zudem sichern sie die effiziente Nutzung erneuerbarer Energien und optimieren die Nutzung von Netzanschlüssen. Notwendig sind effiziente Netzanschlusskonzepte, eine Reform der Strombilanzierung und die Abschaffung der Vergütung bei negativen Preisen.
4. Freiheitsgrade für Behind-the-Meter Anlagen erhöhen
Die Erzeugung und Nutzung von Energie hinter dem Netzanschluss gleicht Volatilität aus und entlastet das Stromnetz. Soweit keine Rückmeldung in das Netz erfolgt, muss der Anschlussnehmer selbst entscheiden können, wie die Anlage aufgesetzt und genutzt wird. Es braucht eine Reform der Netzentgeltstruktur, einen beschleunigten Smart-Meter-Rollout und bessere gemeinschaftliche Erzeugungs- und Nutzungskonzepte.
5. Sektorenkopplung beschleunigen
Wärme- und Mobilitätssektoren müssen regulatorisch mit dem Stromsektor verzahnt werden, damit die Dekarbonisierung diesen Sektoren gelingt. Ein stabiler CO₂-Preispfad sowie eine Reform der Netzentgelte sind erforderlich, um den Umstieg auf Strom wirtschaftlich wettbewerbsfähig zu machen.
„Gern hätten wir das vor den Wahlen nochmal mit den Parteien diskutiert. Aber es gab in den meisten Parteien gar keinen Ansprechpartner für Verkehrspolitik.“ Windelen bezeichnete diese Tatsache als „Armutszeugnis“. Deutschland müsse zeigen, wie es weiter geht mit der Verkehrspolitik, um resiliente Regelungen für die Elektromobilität bereitzustellen.
Öffentliche Diskussion einseitig
Werner Harms von EWE Go, Sprecher des BVES Mobilität, hatte zunächst eine positive Botschaft: Es hat sich viel getan bei der E-Mobilität in den vergangenen 15 Jahren: „Ich bin seit 15 Jahren für E-Mobilität bei der EWE zuständig.“ Im Zuge des Wahlkampfes habe es viel Desinformation gegeben und er habe sich gefragt, warum man noch immer diese Kämpfe führen müsse. „Aber tatsächlich ist es heute etwas anderes als vor 15 Jahren: Derzeit erleben wir eine systemische Transformation.“ Gleichwohl habe er es immer wieder mit Mythen zu tun. Entsprechend müssten Fakten in die Welt getragen werden. Es gehe in Politik und Medien viel zu oft erstens um die Frage, ob genug Ladesäuleninfrastruktur verfügbar ist, und zweites um die Frage, ob der Ladepreis nicht zu hoch ist.
Energiebranche: Fokus auf E-Mobility
„Der Strom soll umsonst sein. Aber wie soll sich das dann finanzieren?“ Drittes Thema sei die Feststellung, wir bräuchten Technologieoffenheit. Er stellte diesen Themen folgende Fakten gegenüber: Zu wenig Ladeinfrastruktur haben wir nicht. Die mittlere Auslastung der verfügbaren Infrastruktur liegt bei 14,5 Prozent in Deutschland. Bezüglich des Ladepreises merkte Harms an, die Diskussion sei so nicht richtig, denn es gebe keinen Zielkorridor und keinen Vorschlag, wie eine Preisreduktion zu machen ist. „Der E-Mobilist fährt schon zu vergleichbaren Preisen wie der Verbrenner-Fahrer, wer zu hause lädt, spart noch mehr.“ Es gebe genügend Gutachten des Bundeskartellamts, die besagen, dass der Ladepreis entsprechend der aktuellen Marktlage sei. Im Europäischen Vergleich seien die deutschen Preise nicht im oberen Segment, sondern im Mittelfeld.
Und was die Technologieoffenheit anbelangt, seien die Wirkungsgrade von Wasserstoff und E-Fuels deutlich schlechter. E-Fuels kommen demnach auf einen Wirkungsgrad von 25 Prozent dessen, was E-Mobilität schafft. H2 brauche das Dreifache an Energie, E-Fuels benötigten gar das 6,5fache für den Antrieb.
Europäisch denken
Harms versuchte den Blick auf wichtigere Fragen zu lenken, als die oben genannten: „Was brauchen wir wirklich?“ Viel zu wenig werde der ökonomische Vorteil des Systems genannt. Zudem müsse man viel stärker europäisch denken, damit das System günstiger wird. „Wir müssen im europäischen Verbundnetz denken“, so Harms, die Dinge gingen aber immerhin in die richtige Richtung. „Wir müssen Projekte zusammen denken, sonst werden wir Probleme gegenüber den großen Weltmächten bekommen.“ Und weiter erklärte er: „Was wir auch brauchen, ist Resilienz.“ Man dürfe nicht nur in Legislaturperioden denken, sonst fange man immer wieder von vorne an. „Wir brauchen einen Pfad, einen Plan, ein Ziel.“
Stefan Quentin von der Unternehmensberatung LCP Delta stellte den rund 200 Zuhörer:innen einige Zahlen und Daten zur Entwicklung der Ladeinfrastruktur und Elektrifizierung bis 2045 vor. „Wo stehen wir? Die gute Nachricht: Die Entwicklung ist nicht aufzuhalten, aber es gibt einige Schlaglöcher.“
Absenkung Flottengrenzwerte
Zum europäischen Markt sagte er: „Was wir 2024 gesehen haben, dass sich der Absatz von elektrischen Fahrzeugen verlangsamt hat.“ Subventionen seien weggefallen und Lebenshaltungskosten gestiegen. „Wir sehen aber langfristig den Trend, dass durch Regulierung E-Mobilität vorangebracht wird.“ Seit Anfang 2025 greift eine weitere Absenkung der Flottengrenzwerte um 15 Prozent im Vergleich zu 2021. Im EU-Durchschnitt dürfen Neuwagen dann noch 93,6 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen. Kritischer Punkt sei, dass keine kostengünstigen E-Fahrzeuge zur Verfügung stünden. Der chinesische Hersteller BYD könne eigentlich günstig anbieten, aber durch Zollaufschläge sei dieser Weg verbaut. Die Ladeinfrastruktur werde zudem weniger wachsen, so Quentin, und daher eine bessere Auslastung erreichen. „Nur wenige Anbieter von Ladeinfrastruktur arbeiten kostendeckend.“ LCP Delta erwarte eine Konsolidierung.
REWE und Burgerking
Alexander Junge, Mitglied Vorstands bei Aral, berichtete dem Publikum, Aral habe Kunden gefragt, was sie sich von Ladepunktbetreibern erhoffen. Ergebnis: Die Menschen wollen nicht gern an abgelegenen Orten in Industriegebieten laden. Sie wollen Toiletten, Essen und Trinken. Darum hat Aral inzwischen in Deutschland an 37 REWE-Märkten und 43 Burgerkings Ladesäulen installiert. Dort also, wo es nicht einsam ist, wo Café- oder Restaurantstrukturen vorhanden sind. Die Menschen wollen auch lieber richtige Menschen um Hilfe bitten als eine Hotline. „Wir schulen Mitarbeiter an unseren Tankstellen, um Fragen zur Funktionalität beantworten zu können.“ Die Verlässlichkeit von Ladesäulen, ein weiterer Punkt auf der Wunschliste der Kunden, sei ebenfalls besser geworden. Trafos ließen sich zum Beispiel aus der Ferne neu starten, wenn eine Störung auftritt. Weitere Erkenntnis: „Kunden wollen gern auch einen höheren Preis zahlen für schnelles Laden; deshalb haben wir in ultraschnelle Ladesäulen investiert; das ist auch die Nutzungsrealität“, betont er.
Gigahub Mönchengladbach
Junge berichtete dem Publikum vom Gigahub Mönchengladbach, ein Ladepark mit 28 Ladebuchten auf 1.500 Quadratmetern. 20.000 Fahrzeuge seien pro Tag in dem Gewerbegebiet und der Ladepark befinde sich wenige 100 Meter von der Autobahn.
Schließlich sprach Junge über regulatorische Hindernisse beim Aufbau ultraschneller Ladesäule. „Die Bundesländer haben ultraschnelle Ladesäulen baugenehmigungsfrei gemacht, denn damals hatte noch niemand an ultraschnelles Laden gedacht.“ Die mit dem Anschluss an die Mittelspannung einhergehenden benötigten Trafos benötigten gleichwohl eine Baugenehmigung. Das wiederum habe zum Spießrutenlauf geführt. In Bayern mussten wir ein Lärmschutzgutachten für die Schnelllader erbringen“, erzählte er. Das habe – neben einer sechsspurigen Autobahn – natürlich nichts ergeben. An anderer Stelle sollte ein Trafo um zwei Meter versetzt werden, von 38 Meter Abstand zur Autobahn auf 40 Meter zu dieser. Und dann gab es noch den Fall, dass ein Gutachten bestätigen musste, dass Bäume in der Nähe eines Trafos nicht beschädigt werden und Menschen auf der Tankstelle wiederum von herabfallenden Ästen nicht erschlagen werden. Auf diese Weise wurde die Umsetzung von Vorhaben um Monate verzögert. Schließlich wurden noch Fahrradstellplätze eingefordert. „Wir haben jetzt die einzige Tankstelle mit Fahrradstellplätzen“, erklärte der Aral-Vorstand der Zuhörerschaft.
Die aktuelle Print-Ausgabe unseres Magazins ERNEUERBARE ENERGIEN finden Sie hier.
Verschiedene Unternehmen, darunter ADS-TEC Energy, Intilion, Pixii, Iwell, Hager Electro, Tesvolt, The Mobility House, Hitachi Energy, Adaptive Balancing Power und Ampermo präsentierten im weiteren Verlauf der Konferenz innovative Lösungen und Best Practices für die Mobilitätswende für Haushalt und Gebäude, Industrie und öffentliche Infrastruktur. Besonders im Fokus stand die Logistikbranche sowie die Herausforderungen im Schwerlastverkehr.
Die zentrale Botschaft der Konferenz war klar: Ohne eine intelligente, flexible und leistungsfähige Schnellladeinfrastruktur wird die Mobilitätswende nicht gelingen. Der Einsatz von Speichern macht es möglich und erschließt die Mobilitätsinfrastruktur für Flexibilität im gesamten Energiesystem. Die Unternehmen, sowohl bei den Anbietern als auch bei den Anwendern stehen bereit und wollen handeln – jetzt ist die Politik am Zug, um die Rahmenbedingungen zu schaffen, die einer zukunftsfähigen und smarten Ladeinfrastruktur den Boden bereiten.