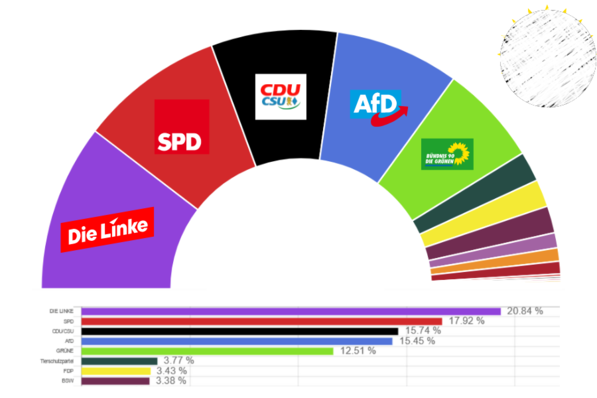„Wir haben immer geglaubt, die besseren Argumente werden sich durchsetzen - ich bin mir jetzt nicht mehr sicher“, sagt der TV-Moderator Eckhart von Hirschhausen auf einer Konferenz der Stiftung Klimaneutralität im Berliner Futurium. Seine Antwort auf das Motto der Konferenz „Was jetzt zu tun ist“: „Nicht verrückt werden.“ Was kann ein TV-Moderator dem Publikum aus Klimapolitik-Expert:innen auf einer Klimakonferenz heute auf den Weg geben? Ein wenig Leichtigkeit, vielleicht. Und das ist nicht wenig in einer Zeit, in der selbst die Grünen sich im Wahlkampf kaum trauen, das Wort Klimaschutz auf ein Plakat zu drucken. Schmunzeln und Nicken unter den Zuhörer:innen, wenn Hirschhausen die Reaktion der Menschheit auf die anthropogene Klimakatastrophe vergleicht mit unserem Verhalten, wenn wir mit voller Blase nachts aufwachen und versuchen, das Gefühl zu ignorieren – doch uns irgendwann eingestehen müssen, dass nur ein Gang aufs Klo die Lage verbessern kann. Was empfiehlt Hirschhausen also den Klimapolitikexperten?
1. Die Psychologie der Tatenlosigkeit in den Fokus rücken
Dafür empfiehlt er den Film „Don‘t look up“ und das Buch „Wir amüsieren uns zu Tode“, eine hellsichtige Analyse von Neil Postman aus den 80ern. Postmans These lautet, dass die Medien zunehmend nicht nur bestimmen, was wir kennenlernen und erleben, welche Erfahrungen wir sammeln, wie wir Wissen ausbilden, sondern auch, was und wie wir denken, was und wie wir empfinden, ja, was wir von uns selbst und voneinander halten sollen. Zum ersten Mal in der Geschichte gewöhnen die Menschen sich daran, statt der Welt ausschließlich Bilder von ihr ernst zu nehmen. An die Stelle der Erkenntnis- und Wahrnehmungsanstrengung tritt das Zerstreuungsgeschäft. Die Folge davon ist ein rapider Verfall der menschlichen Urteilskraft. In ihm steckt eine unmissverständliche Bedrohung: Er macht unmündig oder hält in der Unmündigkeit fest. Und er tastet das gesellschaftliche Fundament der Demokratie an. Wir amüsieren uns zu Tode. Die Botschaft beider Werke: Wegsehen nützt nichts. Wir müssen die Probleme anpacken.
2. „Wenn wir so schlau sind, warum zerstören wir dann unseren Planeten?“ Jane Goodall
Jared Diamonds Buch Krise: Wie Nationen sich erneuern können (2019) mit dem Thema der kollektiven Evolutionsmöglichkeiten könnte hier weiterhelfen. Der US-amerikanische Evolotionsbiologe hatte zuvor mit dem Bestseller Kollaps zunächst die Frage aufgeworfen, warum Zivilisationen untergehen. Der Untergang beginnt immer gleich: Klimakatastrophen, Raubbau an der Natur, rapides Bevölkerungswachstum, politische Fehleinschätzungen. Warum sind Zivilisationen wie die Mayas und die Wikinger zugrunde gegangen, während andere sich behaupten konnten? Und was wird unserer heutigen Gesellschaft den Todesstoß versetzen? In Kollaps geht Diamond diesen Fragen nach. Basierend auf neuesten Forschungen zeigt er am Beispiel Chinas, Australiens und Afrikas, was wir tun müssen, um die ökologische Selbstzerstörung und unseren eigenen Untergang zu vermeiden. Wie Nationen sich erneuern können – das Antwort-Buch sozusagen.
Hirschhausen stellt fest, dass wir bezüglich unserer Klimapolitik 2019 viel weiter waren als heute. Das war vor Corona. Staatsversagen? Für ihn steht fest: „Wir dürfen es nicht zu komplex machen.“ Also sind wir zwar schlau, wie Jane Goodall sagt, aber doch nicht so schlau, wie wir sein müssten? Christian Stöckers „Männer, die die Welt verbrennen“ fokussiert bei unseren verzweifelten Versuchen, die Welt zu retten, ein weiteres Problem: Gier gegen Gerechtigkeit, Zerstörung gegen Nachhaltigkeit, Zynismus gegen Empathie. Nichts zeigt dies deutlicher als die Reaktionen auf die Klimakatastrophe: Hier jene, die versuchen, das Schlimmste zu verhindern, dort jene, die alles tun, um aus dem Verbrennen fossiler Stoffe Profit zu ziehen. Fazit – banal, aber wahr: Ein paar Superreiche könnte viel Gutes bewirken, doch sie tun genau das Gegenteil, weil sie noch reicher sein wollen.
3. Medialer Diskurs in Schieflage
Hirschhausen verweist auf die „Klimakleber“, die Kunstwerke in einem Museum nicht einmal wirklich beschädigt haben mit ihrer Aktion – und dafür gesellschaftlich komplett ins Abseits gedrängt wurden. Aber in Kalifornien sind während der ausufernden Brände aufgrund des Klimawandels gerade zahlreiche Kunstwerke verbrannt. „Warum denken wir das nicht zusammen?“ fragt Hirschhausen. Und tatsächlich fragt man sich das immer wieder, wenn man Nachrichten sieht: Warum wird nur selten die Verbindung gezogen zwischen Klimakatastrophen und dem Thema Klimaschutz? Zwei Themen, die zusammen gehören, werden separat dargeboten. Damit wir uns nicht schlecht fühlen? Oder verlangt das die „objektive“ Berichterstattung?
„Wäre CO2 grün und würde stinken, wäre das Problem längst gelöst“, zitiert Hirschhausen den Klimawissenschaftler Mojib Latif. Unser Interview-Tipp: Latif bei Jung&Naiv. Hirschhausen ist überzeugt, Klimaschutz und Biodiversität: nichts davon regelt ein Markt. Wie man ein guter Vorfahre? Das sollten wir uns fragen. Und wir sollten die Diskurse Klima und Gesundheit verbinden und Geld in das entsprechende Agenda-Setting investieren. Bei der nächsten Bundestagswahl und bei allen anderen Wahlen, die folgen, sollte jedem klar sein: Was steht nicht zur Wahl? Die Luft zum Atmen und das Wasser zum Trinken. Klingt pathetisch, ist aber eine einfache Geschichte, die heute selten thematisiert wird.