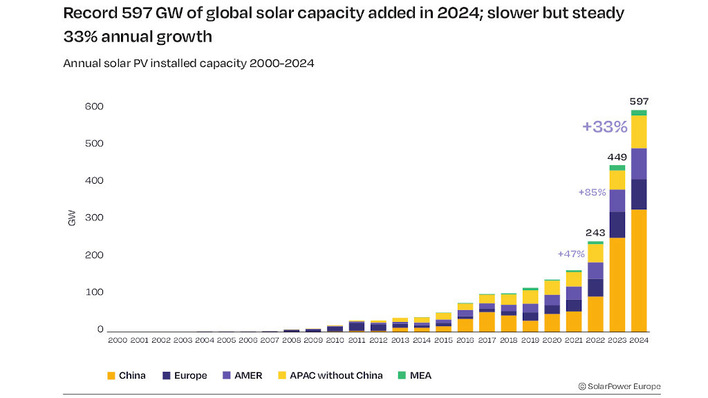Gemeint war es als Annäherung, wahrgenommen wurde es als Provokation: Mitten in eine Kundgebung gegen Atomkraft am schwäbischen AKW Neckarwestheim stellte der Energiekonzern EnBW Ende März ein blaues Riesenbanner: „Lieber Wind, ich mag Dich und ich will Dich. Aber ohne Kernkraft fehlt mir was. Dein Stromnetz“. Einen Monat später, als 120.000 Atomkraftgegner entlang der Unterelbe eine 120 Kilometer lange Menschenkette bildeten, zog E.on am AKW Brokdorf mit einem ähnlichen Transparent nach.
Die Atombranche, lange Jahre vehemente Kritikerin der erneuerbaren Energien, lässt keine Gelegenheit mehr aus, sich als idealer Partner von Wind, Wasser und Sonne darzustellen. Kein Wunder: 95 Prozent der Bevölkerung halten einer Forsa-Umfrage von Anfang des Jahres zufolge den Ausbau und die verstärkte
Nutzung Erneuerbarer Energien für „wichtig“, „sehr wichtig“ oder „außerordentlich wichtig“. Politisch bekennen sich von der Union bis zur Linken alle Parteien zu diesem Ziel. Wer, wie EnBW, E.on, RWE und Vattenfall, längere Laufzeiten für Atomkraftwerke durchsetzen will, muss den Schulterschluss mit den Erneuerbaren üben. Deswegen die Charmeoffensive.
Umweltverbände und -experten halten ihrerseits nach Kräften dagegen. Atomkraft und erneuerbare Energien seien nicht kompatibel, heißt es hier. Von einem Fundamentalkonflikt spricht die Deutsche Umwelthilfe, der Sachverständigenrat für Umweltfragen von einem Systemgegensatz. Wer eine Stromversorgung auf Basis erneuerbarer Energien wolle, müsse Atomkraftwerke abschalten, anstatt ihre Laufzeiten zu verlängern.
Neue Anforderungen
Den Konflikt verdeutlicht eine im Auftrag des Bundesverbands Erneuerbare Energien (BEE) erstellte Studie der Forschungsgruppe „Energiewirtschaft und Systemanalyse“ des Fraunhofer Instituts für Windenergie und Energiesystemtechnik (IWES) in Kassel. Auf Basis der realen Wetterdaten des Jahres 2007 simulierten die Wissenschaftler die Einspeisung von erneuerbaren Energien im Jahr 2020 – unter der Annahme, dass sich deren Kapazität bis dahin auf 111 Gigawatt verdreifacht hat. Grundlage ist das BEE-Szenario „Stromversorgung 2020 – Wege in eine moderne Energiewirtschaft“, das von 6,5 Gigawatt Wasserkraft, 45 Gigawatt Onshore-Windkraft, zehn Gigawatt Offshore-Windkraft, 39,5 Gigawatt Photovoltaik, 0,7 Gigawatt Geothermie und 9,3 Gigawatt Bioenergie ausgeht. Über das Jahr gemittelt läge der Anteil der
Erneuerbaren am Bruttostromverbrauch damit bei etwa 47 Prozent.
Schon bei diesem Ausbaugrad, erläutert Michael Sterner, der Autor der Studie, würden die Erneuerbaren über mehrere Dutzend Stunden im Jahr die komplette Stromnachfrage decken. Für Grundlastkraftwerke, die wie bisher die Atomkraftwerke, mehr oder weniger im Dauerbetrieb unter Volllast laufen, wäre kein Platz mehr im System. „Was wir in Zukunft benötigen, sind flexible Kraftwerke für die Mittel- und Spitzenlast, die schnell an- und abgefahren werden können und dabei robust bleiben“, sagt Sterner.
Die Nachricht ist angekommen. Stellten Verfechter der Atomkraft noch vor wenigen Monaten deren hohen Anteil an der Grundlaststromerzeugung heraus, so ist die Branche nun bemüht, das Image vom kräftigen, aber unflexiblen Atomreaktor schnellstens loszuwerden.
Dass sich die Anforderungen an den fossil-atomaren Kraftwerkspark mit dem weiteren Ausbau insbesondere von Windkraft und Photovoltaik drastisch ändern werden, bestreitet niemand mehr. Wetterbedingt unterliegt deren Leistung starken Schwankungen. Weil Angebot und Nachfrage im Stromnetz stets ausgeglichen sein müssen, um Spannung und Frequenz stabil zu halten, müssen die übrigen Kraftwerke darauf reagieren. Anstatt wie früher nur die – gleichmäßige und gut vorhersehbare – tägliche Verbrauchslastkurve nachzubilden, muss ihre Stromproduktion nun der so genannten Residuallast folgen, der Differenz zwischen Stromnachfrage und Einspeisung aus erneuerbaren Quellen. Diese Kurve verläuft deutlich unruhiger, schlägt schneller, häufiger, heftiger und kurzfristiger nach oben und unten aus. Je nach Wetterlage sind Laständerungen in der Größenordnung von mehreren Dutzend Gigawatt binnen weniger Minuten möglich, die durch Speicher, großräumige Verteilung des Stroms, Anpassung der Elektrizitätsnachfrage an das Angebot und eben durch andere Kraftwerke kompensiert werden müssen.
Auf der Jahrestagung Kerntechnik Anfang Mai verteilte der AKW-Hersteller Areva eine druckfrische Argumentationsschrift zum Thema – Tenor „Kernkraftwerke sind besonders gut geeignet, die Schwankungen der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien auszugleichen“. Ende Mai, wenige Tage vor einem Treffen der Unions-Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung, bei dem die Frage von Laufzeitverlängerungen für Atomkraftwerke auf der Tagesordnung stand, meldete sich RWE-Chef Großmann in der „Zeit“ zu Wort. Die 17 AKW in Deutschland stellten rund 9600 Megawatt an regelbarer Leistung innerhalb von 30 Minuten zur Verfügung, unterstrich er. Das bedeute „Kernenergie und Erneuerbare sind Partner und keine Gegner“. Ein halbes Jahr zuvor hatte RWE diesbezüglich noch
eine etwas andere Einschätzung vertreten. Ideal für Schnellstarts und kurzfristige Leistungsänderungen seien Gaskraftwerke, hieß es damals aus dem Konzern, Steinkohlekraftwerke wiederum könnten auch längere Zeit mit niedriger Teillast und dann zügig hochgefahren werden. Atomkraftwerke hingegen seien konzipiert für den Grundlastbetrieb.
Falsche Annahmen
Als Beleg für ihre neue These von der guten Partnerschaft von Atom- und Windkraft führen Areva wie RWE eine Studie des Instituts für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung (IER) der Uni Stuttgart ins Feld. Ähnlich der IWES-Studie berechnet diese zunächst die Residuallast eines Modelljahres in der Zukunft, basierend auf realen Wetterdaten (in diesem Fall des Jahres 2008), der Verbrauchslastkurve und einem Ausbau-Szenario für die erneuerbaren Energien. Mit diesen Daten startet das IER in einem zweiten Schritt eine Simulation des künftigen Kraftwerksparks, die zwei Fragen beantworten soll. Erstens: Klappt das Zusammenspiel zwischen erneuerbaren Energien und Atomkraft? Und zweitens: Stehen längere Laufzeiten für Atomkraftwerke der Integration fluktuierender erneuerbarer Energien entgegen?
Dazu fütterten die Wissenschaftler am IER ihr Computermodell mit technischen und ökonomischen Betriebsdaten von Gas-, Kohle- und Atomkraftwerken. Unter anderem legten sie für jeden Kraftwerkstyp Anfahrzeit, Mindestleistung und
Leistungsänderungsgeschwindigkeit, Min-
deststillstands-, Mindestbetriebszeit und
Brennstoffkosten fest. Außerdem definierten sie zwei Szenarien: In dem einen, genannt „Laufzeitverlängerung“, sind auch 2030 noch alle 17 AKW am Netz. In dem anderen, genannt „Kernenergieausstieg“, ist 2030 kein AKW mehr in Betrieb, stattdessen gibt es eine größere Zahl von Gaskraftwerken.
Weder in dem einen noch dem anderen Szenario gebe es grundsätzliche Probleme mit der Integration des Ökostroms, fasst Autor Matthias Hundt das Ergebnis der Studie zusammen. In beiden Fällen habe sich der jeweilige konventionelle Kraftwerkspark als flexibel genug erwiesen, um der schwankenden Residuallast zu folgen und jederzeit die benötigten Strommengen zur Verfügung zu stellen. „Die Behauptung, eine Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke sei ein Hemmschuh für den Ausbau erneuerbarer Energien, ist aus technisch-betrieblicher Sicht nicht haltbar“, schlussfolgert Hundt. Auftraggeber der Studie ist der Energiekonzern E.on.
Mit 37 Gigawatt Windkraft onshore,
25 Gigawatt offshore, 20 Gigawatt Photovoltaik, sechs Gigawatt Biomasse und vier Gigawatt Wasserkraft legt das IER seiner Simulation allerdings Ausbauzahlen für die erneuerbaren Energien zugrunde, die weit hinter den im IWES-Modell angenommenen zurückbleiben. Rechnet etwa das IWES bereits 2020 mit einem Ökostromanteil von 47 Prozent, müssen die Atomkraftwerke in der IER-Studie selbst zehn Jahre später nur mit etwa 40 Prozent Ökostrom im Netz zu Rande kommen. Selbst das Bundesumweltministerium ist, was den Ausbau von Windkraft und Photovoltaik angeht, optimistischer.
Sicherheitsbedenken
Die Ergebnisse der IER-Studie legen zudem den Schluss nahe, dass der Ausstieg aus der Atomkraft die Integration der erneuerbaren Energien erleichtert. Die Variante „Kernenergieausstieg“ weist nämlich vor allem wegen der vielen gut regelbaren Gaskraftwerke den Modellrechnungen zufolge ein höheres Potenzial auf, um mit einem weiter steigenden Anteil fluktuierender Einspeisung klarzukommen. Hundt hält seine Studie in diesem Punkt aber für nicht belastbar. Für eine verlässliche Aussage, welche Variante bei einem Ökostromanteil von mehr als 40 Prozent sich als die günstigere erweist, seien weitere Modellrechnungen nötig, sagt er.
Eine entsprechende Folgeuntersuchung sei noch in Arbeit.
Auf der Jahrestagung Kerntechnik sorgte die Expertise des IER bei manchen aus ganz anderen Gründen für heftiges Kopfschütteln. Das Modell gehe von stundenweisem Abschalten der Reaktoren aus, was man so überhaupt nicht mache, kritisierte etwa die Reaktorsicherheitsexpertin Oda Becker. Angaben darüber, wie häufig die Reaktoren in dem Modell komplett abgeschaltet würden, fehlten gänzlich. Und sämtliche sicherheitstechnischen Fragen, die sich aus einer solchen Reaktorfahrweise ergäben, blende die Studie schlicht aus.
Hundt lässt das nicht gelten. Zwar räumt er ein, die An- und Abfahrvorgänge der Kraftwerke nicht näher betrachtet zu haben. Experten von RWE und E.on hätten jedoch bestätigt, dass sich ein Reaktor so fahren lasse. Das Modell unterstelle, dass auch abgeschaltete AKW im heißen Zustand gehalten würden, mit dampfendem Kühlturm sozusagen. Unter diesen Umständen könnten sie tatsächlich binnen drei Stunden wieder auf die angenommene Mindestleistung von 50 Prozent (Druckwasserreaktoren) beziehungsweise 60 Prozent (Siedewasserreaktoren) hochgefahren werden. Oberhalb dieser Schwelle rechne das Modell mit Leistungsänderungen von bis zu fünf Prozent der Nennleistung pro Minute, vergleichbar denen von Steinkohlekraftwerken. Diese Daten habe man den Betriebshandbüchern verschiedener Reaktoren entnommen, in die E.on und RWE in Auszügen Einblicke gewährt hätten.
Tatsächlich, das belegen Unterlagen der Atomaufsicht, enthalten die Betriebshandbücher vieler Atomkraftwerke weit größere Einschränkungen für einen Lastfolgebetrieb, als es die IER-Studie glauben machen will. Das E.on-Kernkraftwerk Unterweser etwa mit einer elektrischen Nettoleistung von 1410 Megawatt, lässt für den Sekundärregelbetrieb – damit sind größere Leistungsanpassungen gemeint – Gradienten von maximal 20 Megawatt pro Minute zu. Das IER unterstellt Hundt zufolge in seinem Modell mehr als das Dreifache. Bei der so genannten Primärregelung, das sind schnelle, automatische Laständerungen zur Stabilisierung der Netzfrequenz, begrenzt E.on den maximalen Hub nach oben und unten auf 45 Megawatt. „Aus Gründen der Anlagenschonung“, sagt Hundt.
Der E.on-Reaktor in Grohnde (1430 Megawatt) soll im Lastfolgebetrieb dem Betriebshandbuch zufolge seine Leistung um maximal zwei Prozent pro Minute ändern. Das AKW Isar-2, ebenfalls von E.on betrieben und einer der modernsten Druckwasserreaktoren in Deutschland, darf seine Leistung im Normalfall demnach auf maximal 64 Prozent absenken. Beim deutlich älteren Siedewasserreaktor Isar-1 sind bisweilen Leistungsänderungen von nur einem Prozent pro Minute, im oberen Bereich noch deutlich weniger zulässig.
Das AKW Neckarwestheim-1 (840 Megawatt), betrieben von EnBW, und einer der ältesten Reaktoren in Deutschland, darf seine Leistung zum Windenergieausgleich ausweislich des Betriebshandbuchs um maximal 30 Prozent drosseln, und dies nur mit einer Geschwindigkeit von weniger als einem Prozent der Nennleistung pro Minute. Die Lastabsenkung darf zudem maximal vier Stunden dauern und maximal einmal pro 24 Stunden erfolgen. Der Hub für den kurzfristigen Abbau von Überkapazitäten im Netz (Minutenreserve) ist sogar auf nur 80 Megawatt beschränkt und ebenfalls nur einmal alle 24 Stunden zulässig. Und in bestimmten Betriebssituationen, etwa beim Hochfahren des Reaktors nach einem Brennelementewechsel, ist eine kurzfristige Leistungsanpassung praktisch gar nicht möglich.
Die Handbücher machen diesen Informationen zufolge zudem keinen Hehl daraus, dass ein Atomreaktor nicht einfach wie ein Auto beschleunigt und gebremst werden kann. Explizit zu beachten sind demnach unter anderem so genannte Xenon-Effekte, Reaktivitätsreserven, Schieflasten und mögliche Interaktionen in den Brennstäben – alles sicherheitstechnisch bedeutsame Punkte. Denn die Kettenreaktion im Reaktorkern ist ein hochkomplexes System mit mehrfachen zum Teil zeitversetzten Rückkoppelungen. So steigt bei einer Leistungsabsenkung die Konzentration von radioaktivem Xenon-135 im Reaktorkern zunächst an. Weil das Neutronengift Xenon Neutronen absorbiert, bremst das die Kettenreaktion zusätzlich und erschwert das Wiederanfahren des Reaktors – wie eine angezogene Handbremse im Auto. Um das Erlöschen der Kettenreaktion zu verhindern, ist ein Gegensteuern – Gas geben – nötig, etwa durch Herausziehen der Steuerstäbe aus dem Kern. Allerdings zerfällt das Xenon binnen einiger Stunden, die Handbremse löst sich also von alleine. Zudem löst sie sich mit wieder ansteigender Reaktorleistung immer schneller. In Tschernobyl führten diese Effekte mit zum Super-GAU. Problematisch ist auch eine ungleichmäßige Verteilung von Hitze, Strahlung und Neutronenfluss im Reaktorkern. Derartige Schieflasten treten etwa bei weit in den Kern eingefahrenen Steuerstäben auf. Unter Sicherheitsgesichtspunkten ist ein gleichmäßiger Reaktorbetrieb daher einem variablen stets vorzuziehen. „Das ist wie beim Flugzeug“, drückt es ein Reaktorexperte aus: „Start und Landung sind am gefährlichsten.“
E.on selbst stellte nach Versuchen im AKW Isar-I fest, dass bei längerem Teillastbetrieb an manchen Stellen im Reaktorkern die Brennstäbe einer sehr hohen Belastung durch Temperatur, Temperaturunterschiede und Neutronenbeschuss ausgesetzt sind – ein sicherheitstechnisches Problem. Wolle man dies vermeiden, hält der E.on-Bericht fest, dürfe man die Leistung des Reaktors nicht so stark absenken.
Kaum Erfahrungen
Reaktorsicherheitsexperten stufen darüber hinaus die extreme thermische und mechanische Belastung und damit den erhöhten Verschleiß der Reaktorbauteile durch häufige Lastwechsel als problematisch ein. Bisher, sagt Becker, gebe es dazu keine aktuellen sicherheitstechnischen Untersuchungen und in der Praxis extrem wenig Erfahrung mit einer solchen Betriebsweise – in den vergangenen Jahrzehnten liefen die Reaktoren ja auch fast ausschließlich im Grundlastbetrieb.
In Frankreich werden zwar seit Jahren an die 40 Reaktoren im Lastfolgemodus betrieben. Einschlägige Betriebserfahrungen mit häufigen, schnellen und großen Lastwechseln gibt es dort aber auch nicht. Kein Wunder: Frankreich hat kaum Windkraftleistung installiert, die Reaktoren müssen lediglich der Tageslastkurve folgen.
In Deutschland nehmen die meisten AKW für sich in Anspruch, bereits im Lastfolgebetrieb zu laufen. Praktisch geht es in vielen Fällen vor allem um
Leistungsregelungen von ±2,5 Prozent zur Stabiliserung der Netzfrequenz
(Primärregelung). Als Musterbeispiel für routinemäßigen Lastfolgebetrieb nennt der Areva-Prospekt das AKW Unterweser, dessen Leistungskurve im August 2009 regelmäßige Absenkungen um bis zu 50 Prozent aufweist, jeweils zwei pro Tag. Anlass war allerdings nicht etwa eine fluktuierende Einspeisung von Windstrom, sondern die Flusstemperatur. Über die Geschwindigkeit der Lastwechsel ist ebenfalls nichts bekannt. E.on machte auf Nachfrage dazu keine Angaben.
In der Praxis, das zeigt ein Blick auf die Leipziger Strombörse, gelingt es den Atomkraftwerksbetreibern noch nicht einmal bei der heute installierten Windkraftleistung, ihre Kraftwerke dem Windstromaufkommen anzupassen. An Weihnachten 2009 etwa sanken die Spotpreise für volle elf Stunden unter Null – das Überangebot an Strom war so groß, dass Abnehmer noch Geld dazu bekamen, zeitweise bis zu 120 Euro pro Megawattstunde. Wegen der Feiertage war der Stromverbrauch niedrig, der Wind blies kräftig. Kein Einzelfall: Allein von September 2009 bis Anfang März 2010 kippten die Strompreise an der Börse an 29 Tagen ins Negative. Wer Strom abnahm, bekam von den Kraftwerksbetreibern für jede Megawattstunde noch bis zu 1500 Euro obendrauf.
Wirtschaftliche Konkurrenz
Steigt der Ökostromanteil deutlich über 40 Prozent, vor allem mit Hilfe fluktuierender Quellen wie Windkraft und Photovoltaik, reicht nach Meinung des IER die Regelkapazität des konventionellen Kraftwerksparks nicht mehr aus. Nötig, so Hundt, sei dann entweder der weitere Ausbau von Speichersystemen oder „eine Regelung der elektrischen Einspeisung aus erneuerbaren Energien“.
Was das bedeutet, zeigt Spanien. An windreichen Tagen müssen dort bereits heute Windkraftanlagen abschalten, weil niemand den Strom abnimmt. Die spanischen Atomkraftwerke dagegen laufen weiter.
Noch verpflichtet das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) die Stromversorger hierzulande, Ökostrom vorrangig abzunehmen. Das jedoch ist nur eine politische Vorgabe – und sie steht im Widerspruch zu den ökonomischen Interessen vor allem der großen Stromkonzerne. Die haben konventionelle Kraftwerke mit einer Leistung von mehreren Tausend Gigawatt installiert, deren Strom sie absetzen wollen. Je mehr Strom aus erneuerbaren Energien ins Netz drängt, desto schwieriger wird das: Konventionelle Kraftwerke werden seltener und oft nur noch in Teillast benötigt. Hinzu kommt, dass bei niedriger Kraftwerksleistung im Regelfall der Wirkungsgrad sinkt und das An- und Abfahren den Verschleiß der Anlagen erhöht. Beides steigert die Kosten.
„Atomkraft und erneuerbare Energien werden sich sehr schnell in die Quere kommen“, prophezeit BEE-Geschäfsführer Björn Klusmann. Die Frage, ob und wie schnell konventionelle Kraftwerke einer schwankenden Residuallast folgen können, ist dabei nur eine unter vielen. Der Systemkonflikt ist weit mehr als ein technisches Problem. Er ist vor allem ein handfester ökonomischer Konflikt um die Frage: Wer darf seinen Strom zuerst verkaufen?
„Bei einem starken Ausbau der erneuerbaren Energien wird es Überschussenergie geben“, sagt Hundt. „Da stellt sich dann
die wirtschaftliche Frage: Baut man zusätzliche Speicher, um die Überschussenergie vor allem aus Windkonvertern im Wälzbetrieb zu veredeln, oder erlaubt man, die überschüssige Windleistung abzuwerfen?“
Erneuerbare Energien nutzen und pri-
vilegieren, um auf konventionelle Kraftwerke und deren Umweltschäden zu verzichten – oder Ökostrom wegwerfen, um konventionelle Kraftwerke weiter betreiben zu können – jenseits aller Rhetorik von vorgeblich guter Partnerschaft wird das die energiewirtschaftliche Machtfrage der kommenden Jahre sein.
Die politischen Entscheidungen von heute, vor allem zur Zukunft der Atomkraft, bestimmen die Machtverhältnisse in dieser Auseinandersetzung entscheidend mit. Denn je mehr konventionelle Kraftwerke künftig noch am Netz sind, desto größer kann der Druck sein, den Vorrang der erneuerbaren Energien zu kippen. Da-
rin steckt, neben allen ungeklärten Fragen bei der Sicherheit der Reaktoren und der Atommüllentsorgung, die energiepolitische Brisanz einer Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke: Sie stärkt – auch ökonomisch – diejenigen, denen am wenigsten an Strom aus regenerativen Quellen gelegen ist. Kippt dann noch der Einspeisevorrang, stellt das den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien, mithin den gesamten ökologischen Umbau der Energieversorgung in Frage. Öffentlich will derzeit niemand die Vorrangsregelung abschaffen. „Man kann sich aber an einer Hand abzählen, dass das die nächste Forderung der Atomkraftwerksbetreiber wird“, sagt Klusmann.
Armin Simon