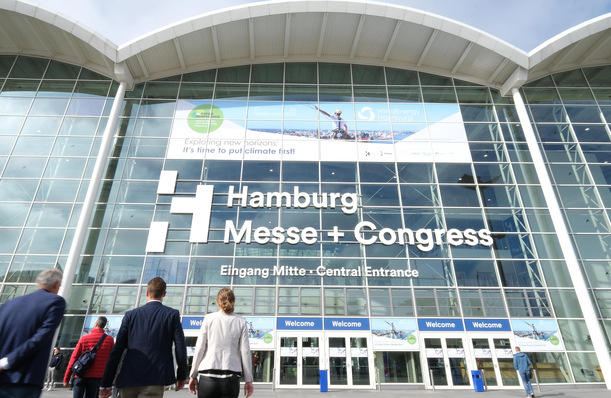Die dringend benötigte Flexibilisierung der Gesamt-Energieversorgung in Deutschland als mutmaßlich neues wichtiges Ziel der kommenden Bundesregierung ließe sich durch konsequente Sektorkopplung zwischen Strom-, Treib- und Brennstoffversorgung weitgehend erreichen. Dies dürfte Haupterkenntnis einer politischen Tagung des Bundesverband Regenerative Mobilität (BRM) vom Donnerstag sein.
Finanzpaket ebnet den Weg für die Energiewende
Regierung will Flexibilität fördern
Die derzeitigen Vorverhandlungen und Beratungen in Berlin für eine künftige Koalition der nächsten Bundesregierung mutmaßlich aus CDU/CSU und SPD lassen im veröffentlichten Sondierungspapier eine neue Offenheit der Bundespolitik für solch eine Sektorenkopplung erkennen: Die Partner in spe wollen „den netzdienlichen Ausbau von Sonnen- und Windenergie, von Bioenergie, Wasserkraft und die Erschließung von Geothermie. Zudem nutzen wir die Potenziale klimaneutraler Moleküle“, versprechen die Unterhändler darin bereits. Außerdem wollten sie „Effizienzpotentiale beim Netz unter anderem durch freiere Gestaltung sowie Überbauung am Netzverknüpfungspunkt“ heben.
Anders als bisher würde Schwarz-Rot, wie das erwartete nächste Regierungsbündnis gemäß Parteifarben heißt, demnach weniger auf eine Komplett-Elektrifizierung der Energieversorgung mit Elektromobilität, Elektroheizen und strombetriebenen Industrie-Hochöfen setzen. Stattdessen wollen die Koalitionsverhandler das vollständige Potenzial grüner Energie einschließlich neuer und alter grün erzeugter Treibstoffe weitgehend ausschöpfen. Außer grünen Elektronen wollen sie reichlich auch grün erzeugte Moleküle verwertet sehen.
Zudem könnte diese nächste Koalition, sollte das Sondierungspapier zu ihrem Vertrag werden, durch Kombination von Wind- und Sonnen-betriebenen Stromerzeugern mit gaserzeugenden Erneuerbare-Energien-Anlagen die Netzanschlussstellen vielleicht sogar mit einem mehrfachen der zulässigen Gesamtleistung überbauen lassen. Davon gehen zumindest die Experten beim BRM aus, wie es die Tagung verdeutlichte. Eine hier geäußerte These: Würden an derart überbauten Anschlusstsellen sowohl Wind, Sonne und Bioenergie, aber auch Elektroautos und Batteriespeicher ihre Energie wechselweise einspeisen und im Falle der Autos und Batterien auch tanken, soll dies sogenannte Dunkelflauten – Phasen ohne grüne Energieerzeugung also – effizient und wirtschaftlich überbrücken, zumindest anteilig.
So machte beispielsweise Sascha Möhring als Geschäftsführer der Möhring-Energie-Gruppe deutlich, wie eine von seinem Unternehmen projektierte Erzeugung grünen Wasserstoffs in Marokko mit Strom aus Wind- und Solarparks einer Größenordnung von bis zu 22 Gigawatt (GW) an einem geplanten Inselstromnetz außerhalb der nationalen Stromversorgung einen mittelständischen und wirtschaftlichen Wasserstoffimport nach Deutschland ermöglichen soll. Binnen 15 Jahren will die Gruppe dafür dort eine Elektrolysekapazität von 10 GW aufbauen. Mit einer Energieerzeugungs-Effizienz von 0,4 würde die Stromgewinnung aus Windkraft dort den Wasserstoff hierzulande nutzen lassen. 40 Prozent der Energie des in Marokko erzeugten Windstroms ließen sich von deutschen Kunden dann bei der Nutzung des Wasserstoffs als Tankfüllung im Verkehr oder als Prozessenergie in der Industrieproduktion noch verwerten.
Mit acht thematischen Fokusbeiträgen zu den Potenzialen grünen Wasserstoffs (H2), also durch Elektrolyse mit Erneuerbarem-Strom gewonnenes H2, zu dessen Erzeugung und Umwandlung auch in leichter transportierbares Ammoniak, zur Überbauung und zu Kombinationen von Wind-, Solar- und Bioenergieerzeugung, zu Speicherkraftwerken sowie zum Potenzial von Biomethan skizzierten die Vortragenden der Verbands-Polittagung, wie weitreichend die Neuerungen sein könnten.
Der Geschäftsführer der 2014 gegründeten Ingenieurgemeinschaft Energethik, Robert Wasser, rechnete vor, wie die künftige Überbauung, aber auch die im sogenannten Biomassepaket frisch eingeführten Regelungen den flexibilisierten Betrieb von Biomethankraftwerken künftig rentabel sein lasse. Hieraus könnten sogenannte Speicherkraftwerke entstehen.
BRM-Vize-Präsident Thorsten Gottwald verwies derweil auf das Potenzial solcher Kraftwerke als Ersatzkraftwerke zur Flexibilisierung der Energieversorgung. Besser als die von Schwarz-Rot bis 2030 vorgesehene Inbetriebnahme zentraler Gaskraftwerke für Stromversorgungs-Großregionen mit zusammen bis zu 20 GW Nennleistung sei ein dezentraler Ausbau der Gaserzeugung aus erneuerbaren Energien geeignet. Hierbei könne die Dunkelflautenbekämpfung in Kooperation auch mit Stadtwerken und an ehemaligen kleineren Kraftwerksstandorten dieser kommunalen Versorger stattfinden. Dies sei angesichts heute überlasteter Verteilnetze besser für den Ausgleich von Engpässen als der Betrieb von Großgaskraftwerken in Süddeutschland.