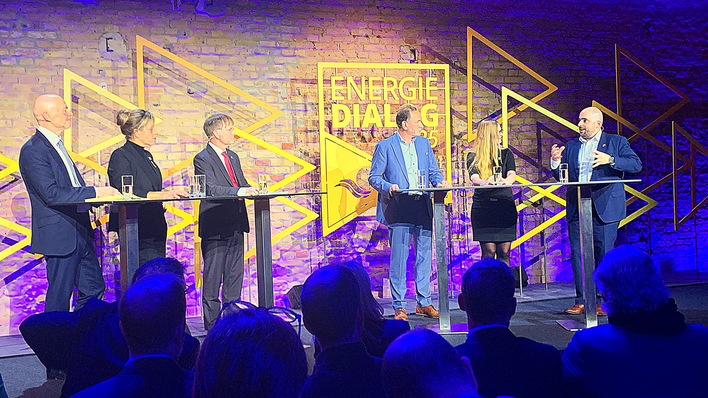13 der 195 nationalen Unterzeichner des Klimaschutzabkommens von 2015 in Paris haben pünktlich zum vereinbarten Termin am 10. Februar ihre nächsten Fünfjahrespläne für Ziele und Maßnahmen bis 2035 vorgelegt. Die sogenannten Nationally Determined Contributions (NDC) – die nationalen Klimabeiträge – müssen die Unterzeichner-Nationen im Fünfjahresrhythmus immer neu einreichen, nachdem sie diese nachgebessert haben. Das Verfahren soll dem Ziel dienen, bis 2100 die weltweite Klimaerwärmung im Vergleich zur vorindustriellen Zeit, bemessen am Mittelwert der Jahre 1850 bis 1900, auf 1,5 Grad zu begrenzen und auf keinen Fall über 2 Grad steigen zu lassen. Weil die Länder bislang nicht genug Maßnahmen angekündigt haben, soll das System der immer neu vorzulegenden regelmäßig nachgebesserten Fünfjahresplanungen dafür sorgen, dass sich die Staaten doch noch dem Pariser Klimaziel annähern. Würden die Länder sich an ihre bisherigen NDC halten, würde dies die Erwärmung nur auf 2,8 Grad Celsius eindämmen, so rechnet das UN-Umweltprogramm vor.
Die 13 jetzt mit neuen Plänen bis 2035 vorangegangenen Länder sind Brasilien als Gastgeberland der nächsten Weltklimaverhandlungsrunde Cop30 im November, die Vereinigten Arabischen Emirate, Neuseeland, die Schweiz, Uruguay, Andorra, Ecuador, Santa Lucia, die Marschallinseln, Singapur und Simbabwe sowie USA und Großbritannien. Von den wirtschaftlich starken Ländern und großen Emittenten der Treibhausgase wie Kohlendioxid (CO2) rechnet der anerkannte Thinktank Climate Action Tracker alleine den Briten gemäß den offiziellen Bemessungsregeln einen ausreichenden Fahrplan zu, um bis 2035 sich 1,5-Grad-kompatibel zu verhalten. Eine solche Übereinstimmung mit den Klimazielen gilt als das Kriterium dafür, dass ein Land den Beitrag leistet, mit dem sich bei gleich gutem Einsatz aller anderen Länder entsprechend ihrer jeweiligen Möglichkeiten das 1,5-Grad-Ziel erreichen ließe.
Wirtschaftsriesen reduzieren ökologischen Fußabdruck bis 2030 nur um ein Drittel
Mehr Grünstrom, aber auch mehr CO2: Top-10-Klimaergebnisse der globalen Nachhaltigkeitszusagen
Nicht kompatibel sind dagegen die von Brasilien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, den USA und der Schweiz vorgelegten NDC. Ohnehin dürfte der Beitrag der USA nicht mehr wichtig sein, weil der im Januar zum zweiten Mal nach vier Jahren Pause ins Amt gestartete neue US-Präsident Donald Trump wie schon in seiner ersten Amtszeit den Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen angeordnet hat. Der wiederholte Austritt nach dem Wiedereintretren unter dem zwischenzeitlichen US-Präsidenten Joe Biden dürfte Anfang 2026 erfolgen. Der Beitrag Neuseelands wiederum gilt gemäß einem vom Fachmagazin Carbon Brief anonym zitierten Experten als „schockierend unambitioniert“. Ein UN-Urteil zum neuseeländischen Beitrag steht noch aus.
Dass die Länder ihre NDC nicht pünktlich vorlegen, gilt als nicht außergewöhnlich. 2020 waren nur 3 von damals noch 184 Unterzeichner-Staaten pünktlich beim Abgaben der NDC für 2030. Die Länder können nun noch bis September ihre 2035-Pläne nachreichen, damit sie beim Klimagipfel im November in Brasilien für die Berechnung des Fortschritts in der weltweiten Klimaschutzpolitik dienen können. Am 6. Februar sagte dazu der UN-Klimachef Simon Stiell, die große Mehrheit der Länder habe angezeigt, dass sie ihre neuen Pläne dieses Jahr vorlegen werden.
Die Länder gäben technische Gründe, wirtschaftlichen Druck und politische Unsicherheit als Begründung dafür an, noch nicht fertig mit ihren neuen NDC zu sein. Aus der Europäischen Union (EU) ist offenbar zu vernehmen, dass eine Abstimmung zwischen allen EU-Ländern im Block in der kurzen Zeit unmöglich gewesen sei. Der weltgrößte CO2-Emittent China hatte bislang keine Abgabe noch in diesem Jahr zugesagt. Das ebenfalls große CO2-Verursacherland Indien hingegen, so heißt es etwa in der indischen Zeitung Indian Express, wolle erst im zweiten Halbjahr den Plan vorlegen. Und der Plan werde die Enttäuschung der indischen Politik darüber spiegeln, dass die hoch entwickelten Industrieländer bei der Vorgängerkonferenz Cop29 in Baku viel geringe finanzielle Beiträge zur Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen in Entwicklungsländern zugesagt hatten, als von vielen gefordert.