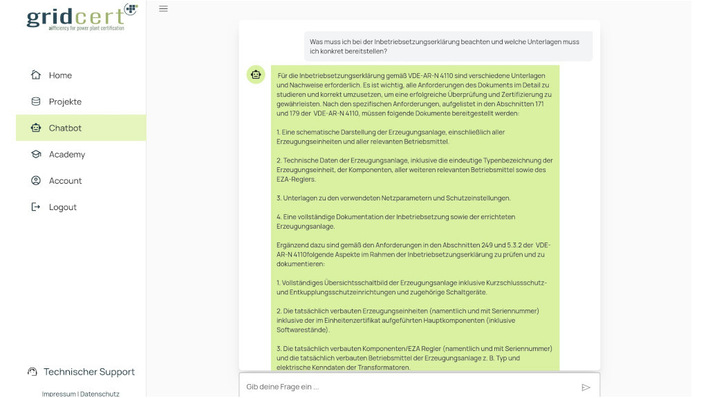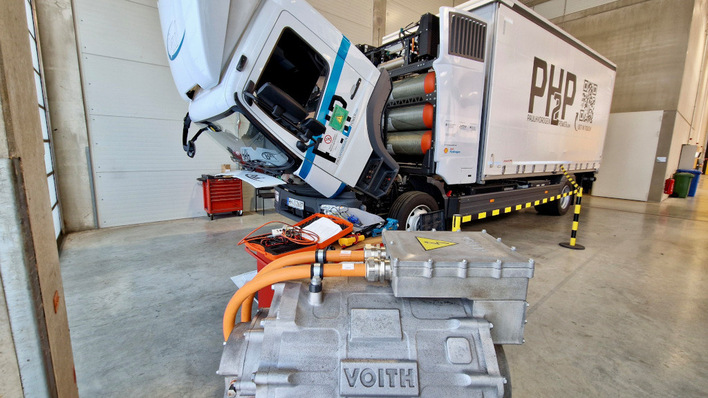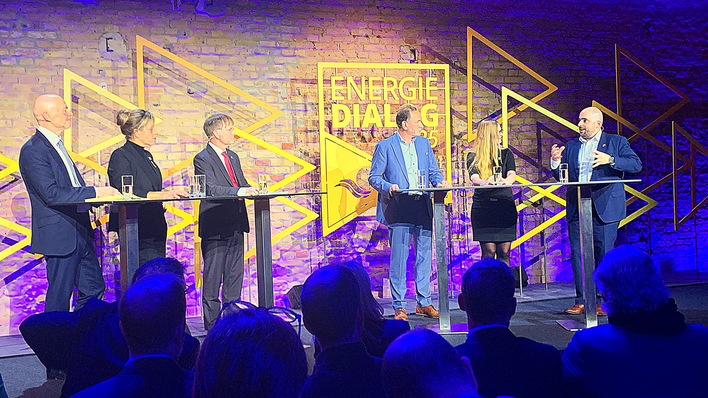Professor Hennicke, warum ist es sinnvoll, sich mit anderen Staaten wissenschaftlich auszutauschen bei der Förderung der Erneuerbaren?
Wenn ich auf den internationalen Kontext schaue, dann haben wir eine wirklich konstruktive, revolutionäre Kostensenkungsentwicklung bei Wind und Photovoltaik. Aber es reicht nicht aus, immer nur die besten Werte aus Saudi-Arabien etwa für Solar oder aus Marokko für Wind zu nehmen. Wir müssen uns auch die länderspezifischen Umsetzungsbedingungen anschauen. Und da ist für uns frappierend, dass die Kosten für Photovoltaik in Japan doppelt so hoch sind wie bei uns oder in China. Die Japaner haben ein enormes Interesse daran zu lernen, wie man nicht nur die Hardware-Kosten, sondern auch die Management-Kosten von Photovoltaik senkt. Da kann man Lerneffekte unterstützen. Und das ist der wesentliche Aspekt, den wir leisten.
Warum fällt es so schwer zu erkennen, dass man voneinander lernen kann?
Wir haben Unternehmensinteressen bei der Kohle und in Japan bei der Kernenergie. Die Abhängigkeit vom Ölpreis durch die Insellage, hat sich in Japan tief ins kollektive Gedächtnis eingeprägt. Man brauchte eine nationale Ressource. Aus meiner Sicht die falsche Entscheidung war, Atomenergie als diese Ressource anzusehen. Heute muss Japan mit einem Fukushima-Trauma fertig werden. Das Land kann aber nicht mit einem Schlag die Energieversorgung in Richtung Erneuerbare umgestalten. Einmal abgesehen davon, dass die zehn großen Oligopole zäh an ihren Kapazitäten festhalten und diese wieder in den Markt bringen wollen. Aber der Widerstand der Öffentlichkeit gegen Atomkraft ist stark. Auch das ist ein Motiv dafür, dass jetzt die gemeinsame Suche nach Alternativen eingesetzt hat. Beide Staaten wollen keine Kohle für die Versorgungssicherheit.
Wie kann es nun gelingen, die Ergebnisse in die Politik zu implementieren?
Man darf angesichts der Vielzahl an internationalen Dialogen zwischen Deutschen und Japan nicht erwarten, dass man nach zwei Jahren nachweisbare Veränderungen in der Regierungspolitik sieht, weder in Deutschland noch in Japan. Das ist auch nicht unser Ziel. Aber unsere Absicht ist, nah an der Politik wissenschaftlich basierte neue Erkenntnisse - die Aktuellsten, die es weltweit gibt - an die Regierung heranzubringen. Wir sind unabhängig, aber wir haben herausragende Köpfe aus beiden Ländern, die sich mit Energiepolitik beschäftigen, in einem Raum und einem Gremium. Also in Richtung Politik formuliert: Stellt uns die Fragen, die ihr gelöst haben wollt. Ihr müsst uns auch Ressourcen dafür anbieten, aber wir trauen uns zu, nach den zwei Jahren auch kulturell notwendiger Annäherungsschritte, dass wir dafür einen Beitrag leisten können. Aber wir möchten nicht Regierungsinstitution werden. Unabhängigkeit zu wahren ist schwer genug für uns und unsere japanischen Partner – frei und unbelastet von den jeweiligen Politikzielen zu denken.
Soll es weitere Kooperationen dieser Art mit anderen Ländern geben?
Absolut. Ich habe die Arbeit in den Enquete-Kommissionen und den Wert der wissenschaftlichen Politikberatung national verinnerlicht, sonst wäre ich gar nicht in die nächste Stufe eingestiegen, um die Erfahrungen auf eine internationale Ebene zu heben. Deutschland und Japan haben eine wichtige Führungsrolle in Südostasien und Europa. Wenn das Modell GJETC Kontinuität schafft und Tiefe in der Untersuchung ermöglicht, sollte man es übertragen zum Beispiel als Modell für Europa, die USA oder auch für Indien. Ich verspreche mir sehr viel von bilateralen, maximal trilateralen Wissensaustausch, weil sonst die unterschiedlichen Rahmenbedingungen zu kompliziert werden. Im Übrigen können zwei Partner dort leichter zu einander finden, wo auch bereits etablierte Kommunikation und Kooperation auf Regierungsebene stattfindet. Das ist zwischen Deutschland und Japan in hohem Maße der Fall.
Interview: Nicole Weinhold