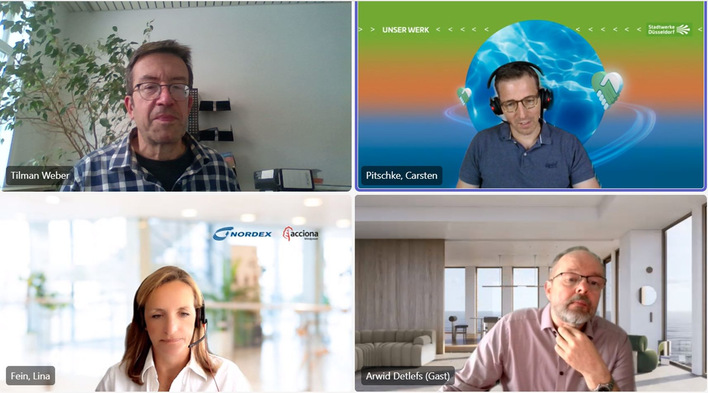Die Windparkprojektierer werden voraussichtlich das durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz für 2030 festgesetzte deutsche Branchenziel einer Windstromerzeugung mit 115 Gigawatt (GW) leicht übertreffen. Das legt eine fundierte und ausführliche Tiefenanalyse vorhandener Daten aus Genehmigungsbehörden, Projektiereraussagen und Registereinträgen durch den neuen Thinktank Goal 100 nahe. Dessen Autoren kommen in ihrem „Fortschrittsbarometer des Ausbaus der Windenergie an Land und Fahrplan auf dem Weg bis 2030“ zum Schluss, dass die Windenergieunternehmen zu Ende 2030 Anlagen an Land mit einer Erzeugungskapazität von rund 118 GW betreiben werden.
Voraussetzung dafür ist, dass sie die aktuelle Dynamik in der Projektentwicklung und beim Realisieren einmal genehmigter Projekte beibehalten. Außerdem geht die Goal-100-Prognose davon aus, dass die inzwischen schneller arbeitenden Zulassungsbehörden von nun an in gleichbleibendem Tempo neue Windparks genehmigen.
Verschobene Windparkprojekte, aber Rekordjahr dank unerwartet hoher Neuzulassungen
Stimmungsbarometer Windkraft: Ein wenig Optimismus trotz hoher Hürden
Windturbinen an Land: 2024 bisher mehr abgebaut als aufgebaut
Wie die zusammengetragenen Daten belegen, haben die Unternehmen mehr als 50 GW bereits jetzt beantragt oder nach erfolgter Genehmigung in die konkrete Umsetzung bis hin zu nun stattfindenden Turbinenerrichtungen übernommen. Schon seit 2023 reichen sie zudem jährlich Anträge für neue Windparkerrichtungen eines Volumens von rund neuneinhalb Gigawatt ein. 2023 mit 9,5 GW und 2024 mit ebenfalls 9,3 GW beantragten sie damit mehr als doppelt so viel wie noch 2021 und 2022, als die Anträge dieser Jahres bereits auf die Rekordvolumen 3,9 und 4,5 GW zielten. In Bezug gesetzt zum Kalenderjahr 2016, das dem bisher besten Zubaujahr für Windparks an Land 2017 vorausgegangen war und zu Anträgen für Projekte mit zusammen 3,4 GW geführt hatte haben die Windenergieunternehmen nun ihre konkreten Planungen sogar fast verdreifacht.
Die aktuell beantragten sowie die nach einer Genehmigung in der Umsetzung befindlichen Projekte mit zusammen also 50 GW sollen nach Abzug der zu erwartenden Stilllegungen von 12,9 GW nicht mehr rentabler älterer Windparks schon mehr als die sprichwörtliche halbe Miete sein: Die Windenergieunternehmen hätten hierdurch etwa 60 Prozent des bis 2030 benötigten Zubaus auf den Weg gebracht, analysieren die Autoren des Thinktanks.
Zu den besonders wichtigen Faktoren zählt Goal 100 die erreichte Beschleunigung der Genehmigungen. So zeigt das neue Dashboard-Portal eine um 20 Prozent rückläufige Genehmigungsdauer im Vergleich zu 2023 an. Statt wie noch im Vorjahr gut 26 Monate, also zwei Jahre und zwei Monate, hatten die neu genehmigten Projekte nur noch eine Genehmigungsphase von 21 Monaten hinter sich, also einen Zeitraum von einem und einem Dreiviertel-Jahr. Dies glich die im Vergleich zum Vorjahr gleichgebliebene Realisierungsdauer von der Projektgenehmigung bis zum Netzanschluss mehr als aus. Die Realisierungsphase betrug 2024 nun 27 Monate nach 27 Monaten im Jahr davor. Vom bisherigen Rekordzubaujahr 2017 an mit im Schnitt noch nur 12-monatigen Realisierungen war deren Dauer zuvor kontinuierlich angestiegen.
Allerdings sehen die Autoren aus dem Thinktank den prognostizierten pünktlichen Zieleinlauf beim Windparkausbau an Land nur dann als ausreichend verlässlich abgesichert an, wenn sich „die Zahl der neu in das Genehmigungsverfahren eingereichten Windenergieanlagen weiter“ steigert.
Warum der „Fortschrittsmonitor“ so präzise sein kann
Das als „Fortschrittsmonitor“ für den bundesweiten Windenergieausbau an Land beworbene Internetportal des Thinktanks berücksichtigt unterschiedliche Genehmigungsdauern, Realisierungszeiten und Inbebriebnahmezeiten nicht nur auf Bundesländerebene, sondern auch im Vergleich von Landkreisen und sogar Gemeinden – und lässt diese über Zeitverläufe hinweg verfolgen. Die Prognose bezieht sich also für jedes entstehende Windparkprojekte auf die regional wahrscheinlichsten Realisierungszeiten.
Als Dashboard soll das Portal für die Branche, für die Politik und für jede interessierte Bürgerin und jeden interessierten Bürger die aktuelle Entwicklungsdynamik des Ausbaus der Windkraft an Land transparent machen. Künftig wollen die Think-Tank-Verantwortlichen „in einem nächsten Schritt“ gemeinsam mit Projektierern und Behörden deutschlandweite Best-Practice-Fallbeispiele und Verbesserungspotenziale herausarbeiten. Ein kompletter Monitoringbericht soll zudem von nun an vierteljährlich erscheinen.
Der Thinktank Goal 100 erhält seine Finanzierung nicht zuletzt vom Internetkonzern Google – und war aus der ebenfalls mit privatem Wirtschaftskapital finanzierten Organisation für zivilgesellschaftlich-wirtschaftliche Kampagnen Project Together hervorgegangen. Dem steuernden Beirat von Goal 100 gehören der Geschäftsführer beim Windenergieunternehmen SL Naturenergie, Milan Nitzschke, sowie der Energiebranchen-Berater David Wortmann an. Das Dashboard sei „eine neuartige digitale Schnittstelle“, die „der Politik, den Behörden und der Branche nun ein verlässliches Instrument zur Verfügung“ stelle, „um den Ausbau der Windenergie gezielt zu steuern“, sagte Wortmann. Bärbel Heidebroek, Präsidentin des Bundesverband Windenergie (BWE), betonte, dass Goal 100 zu konkreten regionalen Verbesserungen im Projektgeschäft des Windparkzubaus an Land führen könne: „Die Dynamik bei Genehmigungen und Zubau weist regional hohe Unterschiede auf, obwohl es um bundeseinheitlich anzuwendende Gesetze geht. Um die Ursachen dafür zu erkennen und pragmatisch gute regional wirksame Lösungen zu finden, benötigen wir größtmögliche Transparenz der tatsächlichen Situation. Diese wird mit Goal 100 erreicht.“
Wie akkurat das Dashboard als Werkzeug arbeiten lässt, dürfte auch von der Genauigkeit der erhobenen Daten abhängen. Zu klären wäre hierbei unter anderem auch, warum die Daten teils von denen der von BWE und anderen Windenergieorganisationen beauftragten Fachagentur Wind und Solar (FA Wind und Solar) etwas abweichen. So geht FA Wind und Solar beispielsweise abweichend von der Goal-100-Analyse von einer durchschnittlichen Genehmigungsdauer von noch 23 Monaten im Vergleich zu 26 Monaten im Vorjahr aus. Das käme einer fast schon halbierten Beschleunigung der Genehmigungen im Mittel gleich – wobei der Trend derselbe bliebe.