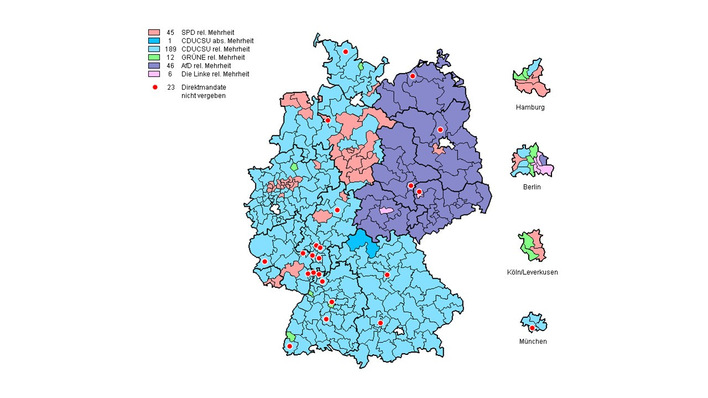Wer in den vergangenen Jahrzehnten in die Projektierung von Windenergieanlagen involviert war, kennt sie, die Hubschrauber-Tiefflugstrecken (HTFS). Ein Netz aus Flugschneisen, die das ganze Land durchziehen und von der Bundeswehr zur Ausbildung von Hubschrauberpiloten verwendet werden. Innerhalb dieser Strecken ist die Errichtung von Windenergieanlagen unzulässig. Das wahre Ärgernis aber ist verfahrensrechtlicher Natur. Denn während die Darstellungskarten der HTFS in vielen Behörden wie selbstverständlich zur Sachbearbeitung verwendet werden, sind sie für Projektierer ein Mysterium: Das Verteidigungsministerium hat sie als Verschlusssache eingestuft. Zwar ist es häufig möglich, bei der Bundeswehr anzufragen, ob ein anvisierter Standort innerhalb einer HTFS liegt. Die Antwort beschränkt sich dabei aber in aller Regel auf Ja oder Nein. Gelegentlich verkommt die Windenergieprojektierung damit zum „Schiffe versenken“-Spiel mit der Bundeswehr. Das kostet Zeit und Geld. Laut einer Umfrage des Bundesverbands Windenergie wurden zuletzt bundesweit 4,5 Gigawatt an Windenergieprojekten aufgrund militärischer Belange blockiert. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr wurden nur etwa 2,4 Gigawatt an Onshore-Windenergie zugebaut – womit das gesetzliche Ausbauziel verfehlt wurde.
Neues aus der Rechtsprechung
Die Maslaton Rechtsanwaltsgesellschaft führt seit einigen Jahren Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit HTFS und macht Informationsfreiheitsrechte geltend. Neben diversen rechtsdogmatischen Fragen von grundsätzlicher Bedeutung geht es dabei insbesondere darum, inwieweit die Bundeswehr ihren Umgang mit den HTFS-Karten nachvollziehbar begründen muss. In einem aktuellen Urteil des Verwaltungsgerichts Köln (Urt. v. 12.12.24, Az. 13 K 2456/24) wurde nun dem Verteidigungsministerium recht gegeben. Interessant ist dabei zweierlei. Erstens die Argumentation des Gerichts: Anstatt selbst zu prüfen, ob die Herausgabe der Karten eine Gefährdung der Bundeswehr darstellt, erklärt es im Wesentlichen, die Ausführungen des Ministeriums für glaubhaft zu halten. Das ist beinahe kafkaesk, da die genaueren Gründe für eine vermeintliche Gefährdungslage ebenso wie die Flugrouten im Nebel der militärischen Geheimhaltungspraxis verblassen. Zweitens lässt das Gericht, was unüblich ist, die Berufung zum Oberverwaltungsgericht zu. In Verbindung mit dem Hinweis auf eine „erhöhte Bedrohungslage“ in der Urteilsbegründung entsteht der Eindruck, dass sich die Richter angesichts der „Zeitenwende“ nicht befugt fühlten, die Rechtsposition der Bundeswehr zu schwächen, sich wohl aber der juristischen Fragwürdigkeit des Status quo bewusst sind.
Es fehlt politischer Druck
Jetzt ist die Politik gefragt: Sie muss erkennen, dass die Zeitenwende nicht schlichtweg darin bestehen kann, allem stattzugeben, das militärisch klingt. Vielmehr müssen militärische Belange durch kluge Gesetze und geschickte Verwaltung in Einklang mit sonstigen Interessenlagen gebracht werden. Der Sicherheit des Landes ist auch nicht gedient, wenn seine Verteidigung auf Kosten der Energieversorgung geht. Ein erster Anstoß aus Baden-Württemberg, bei dem die Bundeswehr dazu gedrängt wurde, HTFS auf ihre Aktualität zu überprüfen, weist in die richtige Richtung. Dort sind nun „nur noch“ 8,2, statt wie zuvor 11,4 Prozent, der Landesfläche für die Windenergie gesperrt.