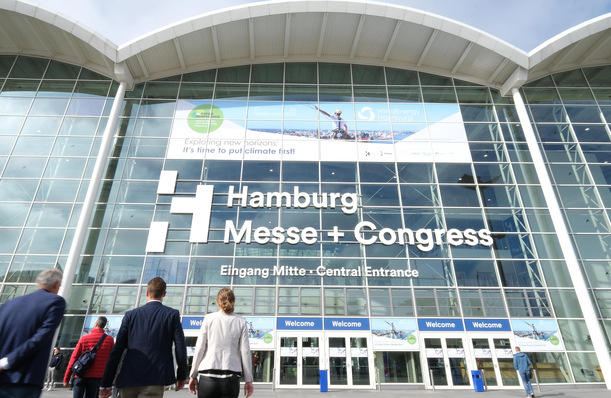Wer schon einmal auf Usedom war, kennt die Warnschilder: Strandbesucher werden beim Bernsteinsammeln vor der Verwechslung mit weißem Phosphor gewarnt. Weißer Phosphor ist gefährlich: Getrocknet fängt er beim Kontakt mit Sauerstoff an zu brennen. Wer also das vermeintliche „Gold der Ostsee“ in die Hosentasche steckt und mit sich herumträgt, riskiert gefährliche Brandverletzungen.
Der Phosphor auf Usedom ist eine Altlast aus den Bombardierungen der deutschen Heeresversuchsanstalt für Raketenforschung in Peenemünde 1943. Zahlreiche britische Bomben verfehlten ihr Ziel, fielen ins Meer und korrodieren seitdem vor sich hin. Der Phosphor gerät ins Meer und wird an den Stränden angespült. Tonnenweise lagert das Gift in der Ostsee.
Es ist nicht die einzige gefährliche Altlast, die die Weltkriege hinterlassen haben. Nach Angaben des Expertenkreises „Munition im Meer“ lagert allein in der deutschen Nord- und Ostsee insgesamt die unvorstellbare Menge von 1,6 Millionen Tonnen Kampfmitteln. Verladen auf einen Güterzug wäre dieser 3.000 Kilometer lang. 2011 sind zuletzt Karten der betroffenen Meeresgebiete veröffentlicht worden, doch systematische Bergungen finden derzeit nicht statt. Funde sind daher eher zufällig: 2015 waren es noch 218. Für 2017 werden die Zahlen Ende März veröffentlicht.
Dass die Zahl an Munitionsfunden überhaupt zunimmt, hat vor allem zwei Gründe: Zum einen beschäftigt sich seit 2011 eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe mit dem Thema. Funde werden erfasst und publik gemacht. Zum anderen werden Meeresflächen immer stärker für den Ausbau der Offshore-Windenergie genutzt. Viele dieser Gebiete wurden nicht nur während des Krieges vermint, sondern auch später gezielt zur Munitionsversenkung genutzt. Und so finden sich im Jahresbericht des Expertenkreises für 2016 insgesamt 61 Kampfmittelfunde im Rahmen von Offshore-Vorhaben, darunter eine russische Ankertaumine, deutsche Sprenggranaten, amerikanische Bomben und eine britische Grundmine.
Verantwortlich für die Suche und die Bergung der Kampfmittel sind die Bauherren. Auch wenn mit der Umstellung auf das Zentrale Ausschreibungsmodell das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) für Flächen in der ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) Voruntersuchungen vornimmt, bleibt dieser Aspekt unberücksichtigt. „Wir wissen nicht, wo nach den Planungen der Ausschreibungssieger die Turbinen genau errichtet und die Kabel verlaufen werden“, begründet Nico Nolte, Leiter der Abteilung Ordnung des Meeres beim BSH. „Wir müssten sonst die ganze Fläche untersuchen, das wäre nicht leistbar.“
Altlasten auffinden
Denn die Suche nach den Altlasten ist kompliziert. Zunächst recherchieren Fachleute in historischen Unterlagen. So kann schon vorab geklärt werden, inwieweit das Offshore-Baufeld beispielsweise bei einem Luftangriff in der Einflugschneise einer großen Stadt lag und damit oftmals besonders belastet ist. Anschließend wird das Baufeld abgescannt. „Eine der größten Herausforderungen ist das punktgenaue Auffinden“, sagt Dieter Guldin, COO bei Seaterra. Ein Schiff schleppt in 150 Meter Abstand die nötige Sensorik hinter sich her, um magnetische Anomalien zu orten. „Bei 40 Meter Wassertiefe, Wind und Wellen geht es je nach eingesetzter Technik um Zentimeter“, so Guldin. Doch nicht jede Anomalie ist ein Kampfmittel: „96 Prozent dessen, was wir orten, ist einfach Schrott. Aber dass wir gar keine Kampfmittel finden, kommt nie vor.“ Das bestätigt auch der dänische Konzern Ørstedt: „Leider muss man feststellen, dass die Nordsee viele Hinterlassenschaften sowohl des Ersten als auch vor allem des Zweiten Weltkriegs aufweist“, sagt ein Sprecher. Es gehöre zum normalen Ablauf, dass Kampfmittelrückstände gefunden würden.
Um zweifelsfrei festzustellen, ob nun harmloser Schrott oder gefährliche Minen im Meer lagern, werden je nach Tauchtiefe Multisensorplattformen eingesetzt, die das Objekt erfassen. Wenn auch sie keine klare Erkenntnis bringen, kommen Kampfmitteltaucher zum Einsatz. Ist dann eine Altlast identifiziert, gibt es verschiedene Optionen. Kann das Kampfmittel geborgen werden? Muss am Fundort gesprengt werden oder kann man es unter Umständen liegen lassen? Gerade beim Verlegen von Kabeln kann auch eine andere Strecke eine Alternative sein.
Aber oft genug muss geborgen oder gesprengt werden – 2016 allein auf der Baustelle des Windparks Veja Mate, 95 Kilometer vor Borkum, zwei Brandbomben, zwei Sprengbomben, eine Grundmine und zwei Übungsbomben. Auf einer anderen Baustelle entdeckten Experten einen Minengürtel, der durch die komplette Planungsfläche verlief. „Immer, wenn ein scharfer Zünder vorhanden ist, müssen wir sprengen“, erläutert Guldin. Doch diese Arbeiten sind teuer. Mit drei bis vier Millionen Euro Kosten müsse man bei einem mittelgroßen Windpark rechnen, so Guldin. Wenn vor allem der Preis einer Kilowattstunde über ein Projekt entscheidet, ist der Kostendruck für alle Beteiligten hoch.
Geräumt wird nur, wo später Kontakt mit dem Meeresboden stattfindet, also an den Positionen der Kabel, der Hubvorgänge bei der Installation der Anlagen und der Fundamentinstallationen. Der Rest bleibt liegen. Dieter Guldin hält das für unklug. „In dem Windpark soll 20 Jahre gearbeitet werden, während im Boden Kampfmittel verrotten.“ Es könne zu spontanen Detonationen kommen. 2017 trieb eine Seemine am Rand des Baufelds von Gode Wind II. In einer aufwendigen Aktion wurde sie abgeschleppt und kontrolliert gesprengt.
Allerdings ist mit den Sprengungen das Problem nicht komplett aus der Welt. Sie bringen Belastungen für die maritime Umwelt mit sich. Schwermetalle und Schwebstoffe gelangen ins Meer, gleichzeitig sind die Detonationen gefährlich für gehörorientierte Meeressäuger wie Schweinswale. Um sie zu schützen, werden Blasenschleier, ähnlich wie beim Rammen der Fundamente, eingesetzt.
Und es gibt noch mehr und grundsätzliche Kritik. Das Problem der Kampfmittel im Meer sei jahrzehntelang kleingeredet worden, kritisiert der Meeresbiologe und Umweltgutachter Stefan Nehring. Er hat 2003 im Auftrag Niedersachsens und Schleswig-Holsteins die anthropogenen Belastungen in der Nordsee untersucht. „Dabei bin ich auf Unstimmigkeiten in Aussagen zur Munitionsbelastung gestoßen, habe anschließend im Koblenzer Bundesarchiv nach alten Akten über Munitionsversenkungen gesucht und bin fündig geworden.“ Seit damals publiziert er regelmäßig zum Thema Munitionsfunde. Bis heute gebe es keine hinreichende Kenntnis darüber, was und wo genau an Munition in welchem Zustand lagere. „Seekarten sind darüber bis heute nicht auf dem neuesten Stand“, kritisiert er. In den 1990ern seien Angaben sogar extra gelöscht worden, um das Problem kleinzureden. Er fordert – bislang vergeblich – eine systematische Identifikation der Hotspots von Munition und ihre Sanierung. Stattdessen findet sich in Verzeichnissen wie der europäischen Datenbank für marine Daten Emodnet keine Kennzeichnung von versenkten Kampfmitteln in der Nordsee.
Das Problem der Kampfmittelaltlasten wird sich indes nicht von allein lösen. Im Gegenteil: „Die Metallhüllen der Sprengstoffe korrodieren und werden später mit heutigen Methoden nicht mehr aufzufinden sein“, sagt Claus Böttcher vom Expertenkreis „Munition im Meer“ in Kiel. Doch verschwunden sind sie damit natürlich nicht. (Katharina Wolf)
Dieser Artikel ist in unserem Print-Magazin erschienen. Mehr exklusive Artikel erhalten Sie, wenn Sie jetzt ein kostenloses Probeheft online bestellen.