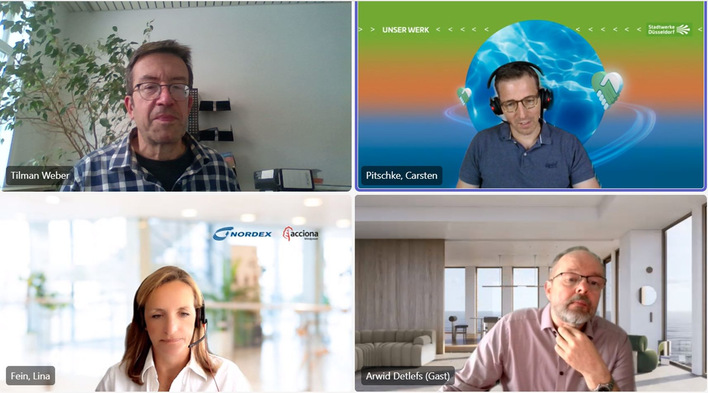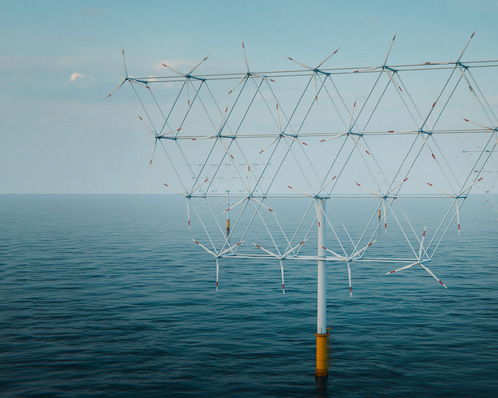Wenn ehemals intensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen mit Photovoltaikanlagen bebaut werden, nimmt die Biodiversität rasant wieder zu. Das ist das Ergebnis einer Studie, die naturschutzfachliche Gutachter Tim Peschel und der Biologe Rolf Peschel im Auftrag des Bundesverbandes Neue Energiewirtschaft (BNE) angefertigt haben.
Dazu haben sich die beiden Autoren der Studie zusammen mit verschiedenen Gutachterbüros die Entwicklung der Artenvielfalt in 30 Solarparks in Deutschland und einer solaren Freiflächenanlage in Dänemark genauer angeschaut. Dabei haben sie von April bis September 2024 acht Artengruppen, darunter Vögel, Amphibien, Tagfalter, Fledermäuse und Pflanzen, kartiert.
Auf Landwirtschaftsflächen konzentriert
Im Unterschied zu den vorherigen Studien zu diesem Thema haben sie sich aber nicht auf Konversionsflächen konzentriert, sondern auf einstige Ackerflächen. Sie sind der Frage nachgegangen, wie schnell sich diese Flächen mit Blick auf die Artenvielfalt regenerieren und wie dies sich auf die Biodiversität in der Kulturlandschaft auswirkt. „Denn in den vergangenen Jahrzehnten ist im Agrarraum viel Biodiversität verloren gegangen, zum Teil in dramatischem Ausmaß“, weiß Tim Peschel.
Flora und Fauna nehmen Strukturen im Solarpark an
Er konnte zusammen mit Rolf Peschel nachweisen, dass diese Verluste wieder ausgeglichen werden, wenn Flächen aus der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung herausgenommen und durch den Bau von Solaranlagen beruhigt wurden. „Denn im Kontrast zur Agrarlandschaft sind im Solarpark verschiedene Strukturen wie Wege, feuchte Bereiche, unter den Modulen im Schatten stehende Gewässer vorhanden“, erklärt Tim Peschel. „So finden wir, auch wenn rundherum alles vertrocknet ist, in Schattenbereichen noch blühende Pflanzen. Diese sind die Grundlage für die Ansiedlung von Insekten. Diese Insekten wiederum sind die Nahrungsgrundlage für Vögel, Fledermäuse und Amphibien. Auf diese Weise können die Flächen die Artenvielfalt entwickeln.“ Die Solaranlagen werden zu Inseln der Artenvielfalt in der landwirtschaftlich genutzten Kulturlandschaft.
KNE veröffentlicht Wissensplattform für Naturschutz im Solarpark
385 Pflanzenarten gezählt
Bei ihrer Untersuchung der Flächen haben die Autoren der Studie beispielsweise 385 Pflanzenarten gefunden, die in der Umgebung nicht mehr vorhanden sind. Darunter sind auch sehr seltene Arten, die sich dadurch wieder vermehren können. Rolf Peschel weist darauf hin, dass die Zahl und die Arten der Pflanzen je nach Region sehr unterschiedlich ausfallen. „Wir haben eine der Solaranlagen mehrfach in verschiedenen Jahren auf Pflanzen untersucht“, sagt Rolf Peschel. „Dabei haben wir herausgefunden, dass diese Anlage doppelt so viele Pflanzen enthält wie die Anlage mit der nächsthäufigen Pflanzenvielfalt. Je häufiger wir die Flächen untersuchen, desto mehr Arten finden wir. Das heißt, die Entwicklung der Artenvielfalt ist in vollem Gange und längst noch nicht abgeschlossen. Wir wissen, dass es immer mehr Arten werden.“
Quellhabitat für Libellenart
Dies gilt auch für die verschiedenen Tierarten, die untersucht wurden. So haben die Wissenschaftler 13 der 79 in Deutschland ansässigen Libellenarten gefunden. Eine von ihnen ist sogar vom Aussterben bedroht. Diese Art baut aber in einem der Solarparks derzeit eine große Population auf. Damit könne diese Fläche als ein Quellhabitat für diese Libellenart angesehen werden, aus dem heraus bislang nicht besiedelte Standorte wieder besiedelt werden können.
3 Tipps von Hirschhausen für die Rettung der Erde
Viele Insekten, Heuschrecken und Vögel gesichtet
Außerdem haben die Forscher 37 Prozent der in Deutschland ansässigen Heuschreckenarten und 17 Prozent der Tagfalterarten in den Solarparks gefunden. Auch bei den Amphibien ist der Bestand bemerkenswert. Immerhin ein Drittel der in Deutschland heimischen Amphibienarten haben die Forscher beobachtet. In den Solarparks fanden sich auch viele Kriechtiere wie Eidechsen. Hier ist vor allem die Erkenntnis wichtig, dass die Solaranlagen meist ohne Anbindung an ein Habitat in der Umgebung existieren.
Zudem konnten die Studienautoren 32 verschiedene Vogelarten in den Solarparks zählen. Darunter befanden sich auch gefährdete Arten wie die Feldlerche, die immerhin in drei Vierteln aller untersuchten Freiflächenanlagen vorkamen. In einem Solarpark hatte sich sogar der vom Aussterben bedrohte Steinschmätzer angesiedelt.
Aktuelle Studie: Landwirte sind gegenüber der Photovoltaik aufgeschlossen
Arten besiedeln die Solarparks sofort
Auch Fledermäuse – zu einem großen Teil ebenfalls bedrohte Arten – konnten die Autoren in den Solarparks nachweisen. „Bisher werden von den Projektierer Ausgleichsmaßnahmen gefordert, weil unterstellt wird, dass ich Vögel und Fledermäuse in den Solaranlagen nicht ansiedeln. Doch bei entsprechender Pflege ist das Gegenteil der Fall“, betont Rolf Peschel. „Die Tiere suchen so dringend neue Lebensräume, dass sie sich sofort im Solarpark ansiedeln. Teilweise gehen die Tiere sogar schon während des Baus der Anlage in die Fläche hinein. Die Tiere haben einen solch großen Druck, neue Lebensräume zu finden, dass es ihnen egal ist, ob da ein Baufahrzeug herumfährt oder jemand Module installiert.“
Die gesamte Studie „Artenvielfalt im Solarpark“ inklusive Hinweise für die entsprechende Planung von Solaranlagen finden Sie auf der Internetseite des BNE zum Download. (su)