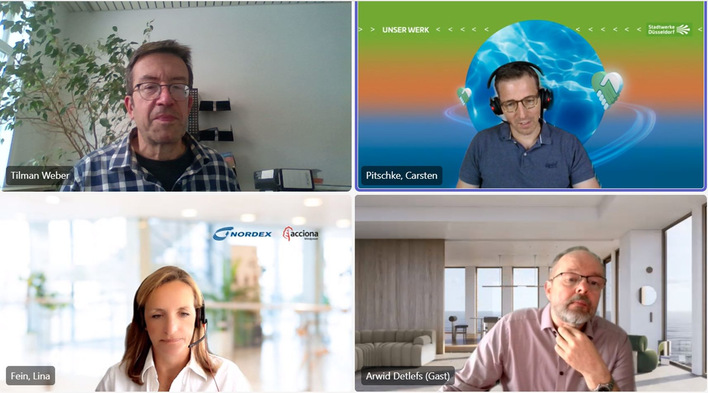Moore speichern eine große Menge an Treibhausgasen, vorausgesetzt, sie sind tatsächlich feucht. Doch derzeit sind rund 70 Prozent aller Moore in Deutschland für die landwirtschaftliche Nutzung trockengelegt. Diese geben die gespeicherten Treibhausgase ab. Dadurch tragen diese trockengelegten Moore in Deutschland jährlich zu etwa 44 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft bei. Insgesamt stammen sieben Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen Deutschlands von entwässerten Moorböden.
Jetzt anmelden zum Webinar am 4. April 2025: Komplexe Photovoltaikprojekte einfach planen
Moore sind vor allem in der norddeutschen Tiefebene und im Alpenvorland verbreitet. Um Deutschlands Klimaziele zu erreichen, müssten mindestens 50.000 Hektar Moorfläche pro Jahr wiedervernässt werden. Für Landwirte, die die trocken gelegten Flächen nutzen, ist das Wiedervernässen wirtschaftlich kein attraktives Modell.
Machbarkeit von Moor-PV untersuchen
An dieser Stelle kann die Photovoltaik weiterhelfen. Denn in Kombination mit einem Solargenerator wird das Wiedervernässen eines Moores für Landwirte interessanter. Wie solche Projekte gelingen können, untersuchen jetzt die Wissenschaftler:innen der Universitäten Greifswald und Hohenheim zusammen mit dem Johann Heinrich von Thünen-Institut und dem Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE). Sie wollen im Projekt „Moor Power“ zunächst die generelle Machbarkeit von Photovoltaikanlagen auf Moorböden bei gleichzeitiger Wiedervernässung untersuchen.
Zusätzliche Einnahmequelle für Landwirte
Dazu kommen noch Bewertungen der Wirtschaftlichkeit solcher Projekte für die Landwirte. Denn die Stromerzeugung mit Moor-PV bietet Landwirtschaftsbetrieben eine zusätzliche Einnahmequelle. Diese kann dann der Anreiz zu mehr Wiedervernässung in Deutschland sein. Ziel von „Moor Power“ ist es, Handlungsempfehlungen zur konkreten Umsetzung von Moor-PV zu erarbeiten. „Die parallele Planung der Photovoltaikanlage und der Wiedervernässung ist absolutes Neuland“, weiß Agnes Wilke, Projektleiterin für Moor-PV am Fraunhofer ISE. „Im Rahmen des Projektes möchten wir durch die konkrete Implementierung die beste Herangehensweise für Moor-PV-Anlagen erproben“, sagt sie.
Verschiedene Anlagenvarianten testen
Im ersten Schritt bauen die Wissenschaftler:innen auf einer Experimentalfläche in Mecklenburg-Vorpommern auf insgesamt sechs Hektar verschiedene Designs von Moor-PV-Anlagen auf einem noch landwirtschaftlich genutzten Niedermoor mit unterschiedlichen Aufständerungshöhen, Solarmodultypen und Fundamenten auf. Jede Variante der Solaranlage wird dann in Kombination mit drei unterschiedlichen Bedingungen der Wiedervernässung untersucht. Diese unterschiedlichen Bedingungen beziehen sich dabei auf die Wasserstände. Im Mittelpunkt stehen dabei auch ökologische Fragestellungen.
EU-Kommission nimmt Photovoltaik in die Landwirtschaftsstrategie auf
Geeignete Materialien finden
Gleichzeitig kann das Projektteam auf einer Materialtestfläche in Baden-Württemberg unterschiedliche Materialien, Beschichtungen und Methoden für die Fundamente der besonderen Solaranlagen kleinflächig testen. Zudem werden die Auswirkungen der Beschattung durch die Anlagen auf die moortypischen Pflanzen in Topfversuchen untersucht
Photovoltaikanlage entsteht im Moorgebiet Varel
Treibhausgasbilanz analysieren
Danach bauen die Forscher:innen auf einer etwa 200 Hektar großen Moorfläche in Niedersachsen eine größere Photovoltaikanlage auf. Sie wollen hier unter anderem die Treibhausgasbilanz auf Landschaftsebene analysieren. „Wichtig ist, für die Doppelnutzung aus Kohlenstoffspeicherung im Torf und Produktion erneuerbarer Energie per Photovoltaik nur entwässerte und stark degradierte Moorflächen zu erschließen, also die derzeit landwirtschaftlich genutzten Moorböden“, erklärt Jürgen Kreyling von der Universität Greifswald. „Es muss verhindert werden, dass Moorböden für die Installation von Photovoltaikanlagen genutzt werden, ohne dass diese auch wiedervernässt werden. Denn dann würden die Treibhausgasemissionen aus den Moorböden kontinuierlich weitergehen. Naturschutzfachlich wertvolle Moore und Moorböden innerhalb gesetzlicher Schutzgebiete sind hingegen ausgenommen.“
Sonnenstrom von Acker und Scheune: Unser Spezial für die doppelte Ernte in Agrarbetrieben
Bisher nur ein umgesetztes Projekt bekannt
Die Installation von Solaranlagen auf wiedervernässten Moorflächen ist noch neu. Deshalb bestehe erheblicher Erprobungs- und Forschungsbedarf, um die Machbarkeit und die Auswirkungen beurteilen zu können, betonen die Wissenschaftler:innen. In Deutschland ist bisher nur eine Anlage auf einem wiedervernässten Moor bekannt. Außerhalb Deutschlands wurden nach Angaben des Projektteams bisher noch keine solchen Projekte errichtet.